Ich liebe meine Arbeit. Vielleicht noch ein bisschen mehr, seit ich Kinder habe. Ich liebe sie so sehr, dass ich es überhaupt nicht schlimm finde, selbst jetzt im Urlaub morgens ein paar Stunden zu arbeiten. Ich gebe es zu, ich war tatsächlich ein wenig enttäuscht, als mein Kleinster heute Morgen nicht wie sonst begeistert in den Kinder-Club gerannt ist. Ich habe dann doch kurz gearbeitet, so gut es geht mit ihm auf dem Schoß und dann sind wir zwei im Schnee spazieren gegangen. War auch schön – trotzdem hat mir was gefehlt. Als ich Ingas Geschichte gelesen habe, habe ich mich daher sehr verstanden gefühlt…

In den letzten 21 Monaten ist irre viel passiert, vor allem in mir drin. Da sind Gefühle erwacht, von denen ich bisher gar nicht wusste, dass sie in mir schlummern. Und der Begriff Familie hat eine viel stärkere Bedeutung für mich bekommen. Bisher war es für mich ganz selbstverständlich, Teil einer Familie zu sein. Mutter, Vater, großer Bruder, so war das schon mein Leben lang. Durch die Geburt von Maja ist diese Familie aber nicht einfach nur größer geworden, sondern auch bedeutender, intensiver, aufregender, kribbeliger, bunter, verrückter und lebhafter. Nur eines ist sie nicht: selbstverständlich.
Ich trage plötzlich eine vorher nicht gekannte Liebe in mir, deren Intensität mich immer wieder staunen lässt. Liebe für Maja, aber auch für uns als Familie. Mein Herz ist so viel voller als vor ihrer Geburt, auch wenn ich nun nicht mehr der Mittelpunkt meines Lebens bin, sondern sie. Ich spiele jetzt die zweite Geige und genau das war und ist gar nicht so einfach, denn je mehr ich in meine Mutterrolle schlüpfte, desto weniger fühlte ich mich als Frau. Es wollte mir einfach nicht gelingen, diese beiden Schlüsselfiguren unter einen Hut zu kriegen. Der Hut war zu klein – er bedeckte immer nur entweder das eine oder das andere Ohr.

Ich fühlte mich plötzlich so unbedeutend, auch wenn ich mehr leistete als je zuvor. Auch optisch war ich auch schon mal besser drauf. Eine Freundin ist etwa zur gleichen Zeit Mutter geworden wie ich und was soll ich sagen, sie sieht nie fertig aus. Sie ist eine dieser WOW-Frauen: Tolle Kleider, lackierte Fingernägel, dezenter Lippenstift und volle, glänzende Haare, die sie fast immer offen trägt. Ich trage an mindestens 300 Tagen im Jahr Jeans, die vom vielen Am-Boden-Rumkriechen an den Knien schon ganz blass sind und einen etwas strubbelig wirkenden Pferdeschwanz, denn für einen ordentlichen habe ich zu viele Wirbel. Und morgens zu viel Wirbel.
Einmal, nachdem ich die WOW-Frau traf, holte ich mein schönstes Kleid aus dem Schrank, legte ein bisschen Lippenstift auf, föhnte meine Haare über die Rundbürste und lackierte mir die Fingernägel in einem dunklen Rot. Ich betrachtete das Ergebnis von oben bis unten und – fühlte mich verkleidet. Ich mochte so für andere eine WOW-Frau sein, für mich war ich es nicht. Der erhoffte Aha-Effekt blieb aus, dafür war da plötzlich eine andere Erkenntnis: Es war gar nicht mein Aussehen, was mich so nervte. Auf jeden Fall nicht nur. Aber warum war ich dann oft so unzufrieden mit mir selbst und mit dem was ich hatte?
Dann kam der Tag, der alles änderte. Ich fing wieder an zu arbeiten. Ich bin freie Journalistin und so saß ich nach langer Zeit mal wieder in meinem Homeoffice am Rechner und suchte Bilder für eine Wohngeschichte raus. Es vergingen Stunden, ohne dass ich auch nur einmal auf die Uhr sah. Immer wieder merkte ich, wie ein zufriedenes Lächeln über mein Gesicht huschte. Schon verrückt: Was früher Routine war, löste plötzlich Glücksgefühle in mir aus. Mir war nie klar, wie sehr ich das Arbeiten vermisst hatte und wie wichtig es für mein Selbstbewusstsein war. Endlich drehten sich meine Gedanken mal wieder um etwas anderes als das Muttersein. Das tat gut. Verdammt gut sogar. Jeden Tag setze ich mich nun wirklich gerne an den Rechner. Man könnte sagen, ich habe inzwischen eine gesunde Work-Child-Balance. Und genau die macht mich auch als Mutter wieder glücklicher, denn natürlich bin ich gerne Mutter und auch stolz darauf.

Ich nenne sie liebevoll Futzie, manchmal auch Schlawiner. Sie mag das. „Wer ist ein Schlawiner?“, frage ich sie. „Maja!“ kommt es wie aus der Pistole geschossen und ihre großen blauen Augen leuchten. „Und wer ist ein Futzie?“ „Maja!“ „Und wer ist Mamas größtes Glück?“ „Maja!“ Und genauso ist es. Ich schnappe sie mir und drücke sie ganz fest. Auch wenn das Muttersein für mich Anstrengung, Erschöpfung und gelegentliche Fremdelphasen mit mir selbst bedeuten, so bedeutet es eben auch lachen, lieben, Quatsch machen und viiiiel mehr Küsse. Aber meine Arbeit, die gehört eben auch dazu.
Liebe Grüße, eure Inga
Danke, Inga, für deine Geschichte! Wie ist es denn bei euch? Arbeitet ihr auch so gern – oder ist Arbeit eher ein notwendiges Übel? Oder arbeitet ihr ganz bewusst zur Zeit gar nicht an einem Schreibtisch?
Alles Liebe,








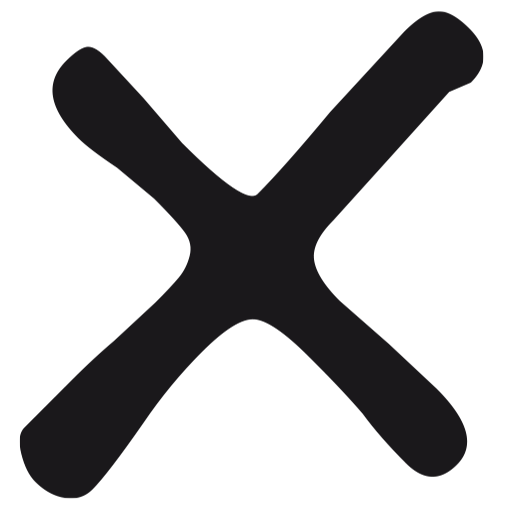
Liebe Claudi, liebe Inga,
ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe zwar die Arbeit nie als mein Leben oder meine Berufung empfunden, dafür bin ich in das, was ich mache auch viel zu zufällig reingerutscht, aber ich kann mich gut an eine Situation erinnern, als unsere Tochter etwa 3 Monate alt war. Es hatte sich soweit ganz gut eingespielt, aber ich fühlte mich kopfmäßig irgendwie unterfordert.Und als es dann noch regnete und wir an dem Tag nicht aus dem Haus kamen, dachte ich, mir fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Ich bin dann nach 8 Monaten mit 10 Stunden in der Woche wieder angefangen zu arbeiten. Die Kleine war bei Oma und Opa und es hat uns beiden gut getan. Seit knapp zwei Jahren geht sie nun in die Krippe und ich arbeite jeden Vormittag. Und damit sind wir gut zufrieden. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen wieder Vollzeit zu arbeiten. Wir haben so also auch unsere Work-Child-Balance gefunden.
Liebe Stephanie,
es muss ja auch gar nicht Vollzeit sein. Da sollte jeder auf sein Bauchgefühl hören, mit wievielen Stunden er sich wohlfühlt. Bei mir sind auch “nur” 25 Stunden der Schlüssel zu meiner perfekten Work-Child-Balance. Liebe Grüße, Inga
Hallo Hallo, ich bin nach Kind 2 derzeit noch in Elternzeit und auf der Suche nach dem großen Job-Glück… beim Gedanken, bald wieder zu arbeiten, kribbelt es ganz arg im Bauch… aber vor allem vor Nervosität, was nach 3 Jahren Pause da auf mich zu kommt. Liebe Grüße von der kaputte-Knie-Jeans-Vertreterin Sabrina
Liebe Sabrina,
ich kann deine Aufregung gut nachempfinden. Mir ging es ganz ähnlich vor meinem Wiedereinstieg. Ich drücke dir die Daumen für einen tollen Start. Vermutlich wird es sich schnell so anfühlen, als wärst du nie weg gewesen. 😉 Liebe Grüße, Inga
So wahr und ehrlich geschrieben, danke, liebe Inga :)!
Ganz mein reden, ich bin sehr gerne Mama, ich bin sehr gerne Arbeitende UND ich habe Sehr gern Me-Time sowie ich auch Sehr gerne Ehefrau bin.
Genau das alles (und bestimmt noch ein paar andere Rollen), brauche ich dringend für meine persönliche Glücks-Balance. Ich kann mir nicht vorstellen, nur eins davon zu sein, so wie ich mir auch nicht vorstellen kann, eins davon nicht zu sein.
Liebe Teresa,danke für deine lieben Worte! Liebe Grüße, Inga
Hallo,
Ich bin zur Zeit mit meinem Jüngsten zuHause. Die anderen Kinder sind bis mittags in Schule bzw. Kindergarten. Mein Mann ist Alleinverdiener und ist viel auf Dienstreisen, (was er auch gern macht).wir haben uns bewusst Diese „ klassische“ Aufteilung entschieden, einfach, weil es so für uns am besten passt. Ich habe bei meinen zwei ältesten Söhnen gearbeitet ( in der Pflege, später in einem Kindergarten), aber es war einfach nicht möglich, eine gute Balance zu finden( schichtdienste…). Seit Sohn Nummer drei bin ich zu Hause, mein Mann arbeitet Vollzeit. Mit mittlerweile 6 Söhnen (15,11,7,5,3,1) bin ich mit Wäsche, putzen und einkaufen vormittags gut ausgelastet… für etwas anderes wäre sowieso keine Zeit ?, mittags hole ich die drei mittleren Jungs ab. Ich nähe als Ausgleich die ein oder anderen Auftragsarbeit für Kindergärten etc. Für uns ist es so genau richtig und ich möchte es nicht anders haben!
Lg von Maria
Hut ab, 6 Söhne sind ein Vollzeitjob. Der Tag ist ja schließlich endlich ;).
LG
Linnea
Ich kann das gut nachvollziehen, bei beiden Kindern hatte ich mir eigentlich längere Elternzeiten vorgenommen, als ich es dann letztendlich realisiert habe… Mit dem Mamasein bin ich auch glücklich, aber ich fühlte mich immer mal wieder auch einsam, gerade, weil bei uns keine Familie in der Nähe ist und nicht so viele Freundinnen auch gerade Babys hatten.
Mein Job gibt mir da nochmal ganz andere Inputs und ich kann so viel gestalten. Zuletzt habe ich mit zwei Kindern Vollzeit mit 40h gearbeitet, genauso wie auch mein Mann. Nach Kind3 wird das sicher organisatorisch schwierig, aber weniger als 30h möchte ich keinesfalls. Unser Großer ist jetzt 8 und so aufgewachsen. Er findet meinen Job sehr spannend und begeistert sich sehr dafür, dass ich viel gestalten, über Geld entscheiden und mit Personal arbeiten kann. Weiterhin viel Spaß als Mama mit Job!
LG
Linnea
Hallo Claudi, hallo Inga,
Ich habe mit viel Neugier eure Texte gelesen und gerade in der Geschichte von Inga habe ich mich an vielen Stellen wiedergefunden.
Der Job als Mutter, den man von heut auf morgen antritt, ist für viele von uns am Anfang die hauptsächliche Tagesaufgabe. Während man von heut auf morgen in diese Rolle hineingewachsen muss, fühlte ich mich nach drei Monaten aber schon als Kenner und nach einem Jahr fast schon als Profi.
Dann kam nach 1 1/2 Jahren Elternzeit der Wiedereinstieg in den beruflichen Job- und nach der Pause fühlte ich mich hier nun fast wieder als Anfänger.
Und doch hat sich so viel verändert: ich bin in meinem Beruf sehr viel ausgeglichener und lasse mich nicht mehr von kleinen Katastrophen stressen. Die Arbeitszeit verfliegt bei 5Std. am Tag und ich bekomme währenddessen sogar heißen! Kaffee- welch ein Lusxus.
Die eigentliche Arbeit beginnt für mich dann erst nach Feierabend.
Auch wenn sie nicht vergütet wird, so ist sie unbezahlbar schön und erdet mich.
Viele Grüße,
Julia