Was ich mir ausmale: Wir fünf, fröhlich lachend und plappernd im Auto auf dem Weg zum Badesee. Was wirklich ist: Auf der Rückbank herrscht Anarchie – zwei brüllen, eine schmollt. Und vorne schweigen wir uns grimmig an, weil der Zoff mit den Kinder so ansteckend wie Windpocken ist. Die Leichtigkeit in Gedanken erleidet Totalschaden im Zusammenprall mit der Realität. Wieder mal…
Unser Familienleben ist ein dauernder Abgleich zwischen Soll und Ist, eine permanete Übung in Frustrationstoleranz, dass Dinge sich komplett anders entwickeln als erhofft. Anders als geplant. Denn ganz gleich, ob wir spontan den Grill anschmeißen oder einen Kindertag ausrufen, weil es doch so schön ist als Familie gemeinsam schöne Dinge zu machen – mindestens einer schießt immer quer. Springt mit Anlauf in das hübsche Bild, das man gerade noch vor Augen hatte. Und lässt es in 1000 Scherben splittern.
Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen an zu viele und zu kleine Kinder.
Vielleicht sollte ich es nach neun Jahren Mutterdasein inzwischen besser wissen. Und doch tappe ich immer wieder in die gleiche Gedankenfalle, die mir etwas vorgaukelt, was sich definitiv anders entwickelt. Warum ich dennoch daran festhalte? Vielleicht, weil ich darauf hoffe, dass es dieses eine Mal anders wird. Dass wir zu dieser Familie werden, die ich mir gerade detailreich ausmale: Alle froh, kooperativ, dankbar für die schöne Zeit, die wir uns bereiten wollen.
Nur: Kinder, vor allem kleine, sind nicht dankbar. Kinder sind Kinder – und ihren Emotionen unterworfen. Und zwar hundertmal mehr als den Erwartungen ihrer Eltern. Das ist gesund, richtig und absolut gut so. Wenn sie gerade Geschwister-Beef mit der kleinen Schwester haben, können sie nicht nebenher noch ein fröhliches Lied auf den Lippen tragen. Das ist eine Frage der Prioritäten.
Natürlich weiß ich das eigentlich. Und stoße mir doch immer wieder meine Hoffnungen daran wund. Bin enttäuscht, manchmal wütend. Weil: Ich hatte mir doch Mühe gegeben, Gedanken gemacht. Wollte für alle etwas Schönes. Oder wollte ich es eigentlich vor allem für mich?
Ich merke immer wieder: Gerade Aktionen sind mit Annahmen überfrachtet, die mit der Realität nicht Schritt halten können.
Auch wenn uns die sozialen Medien jeden Tag das Gegenteil weismachen wollen. Bei uns rennen die Kinder nicht friedlich Hand in Hand dem Sonnenuntergang entgegen. Oder wenn sie es tun, haben sie sich vorher gegenseitig die Schaufel über den Schädel gehauen und sich mit “Das kriegst du jetzt voll zurück”-Schlachtrufen gejagt. Das eine harmonische Bild trägt ungefähr so viel Wahrheitsgehalt in sich wie Cola Vitamine hat.
Genauso ist es mit den Bildern in meinem Kopf. Ich sehe eine bestimmte Szene vor mir – und wenn sie nicht so eintritt, bin ich frustriert. Wenn ich nicht aufpasse, ist das das vorherrschende Gefühl, das am Ende bleibt. Was ich dabei immer noch viel zu oft übersehe: Häufig wird es anders schön.
Vielleicht prügeln sich die Kids noch auf dem Parkplatz – und sind eine Viertelstunde später in Harmonie und mit Eis vom Strandkiosk friedlich vereint. Oder ein Kind steht beleidigt vom Grillen auf – dafür führe ich mit dem anderen ein wirklich inniges Gespräch. Ein Kind haut ab – und entdeckt dabei den Mega-Spielplatz, auf dem alle später einen super Nachmittag haben. Das kann ich aber nur richtig genießen, wenn ich nicht in dem Gefühl stecken geblieben bin, dass ich mir alles doch ganz anders vorgestellt habe.
Aber das Drehbuch unseres Familienlebens schreibe in den seltensten Fällen ich.
Was vielleicht nicht schlecht ist, denn würde ich den schmeichelnden Filter-Bildern in meinem Kopf ein Skript einhauchen, würde am Ende eine kitschige Hollywood-Schmonzette herauskommen. Da wir aber alle fünf Co-Autoren unserer Familien-Serie sind, erinnert die fertige Szenerie eher an schnörkelloses Autorenkino.
An diese Filme, die Stolpersteine und Abgründe hell ausleuchten statt sie gnädig zu überblenden. In denen die Helden zugleich auch Anti-Helden sind. In denen es meistens anders kommt als erwartet. Und wenn ich ehrlich bin, schaue ich mir solche Streifen viel lieber an als cleane RomComs.
Eine wichtige Erkenntnis ist auch diese: Wir alle zusammen harmonieren nicht zwingend.
Tatsächlich eher ziemlich selten. Bilder von uns als kompletter, glücklicher Familie kann ich mir eigentlich per se sparen. Denn: Bei fünf Menschen prallen so viele unterschiedliche Bedürfnisse, Meinungen, Wünsche aufeinander, dass ein gemeinsamer Nenner oft mehr K(r)ampf als Spaß ist. Dass es einfacher ist, uns aufzuteilen – und mit mehr Raum und Ruhe schöne Augenblicke zu erleben, die im Kollektiv so meist nicht möglich sind.
Also eher mit den beiden Kleinen zum Badesee düsen – und Papa kickt mit dem Großen Fußball. Oder ich nehm den Neunjährigen auf meiner Joggingrunde mit – und die beiden anderen kriegen eine exklusive Vorlesestunde. Das mag als Event nicht ganz so herausragend sein wie der tolle Ausflug. Aber manchmal sind es genau diese unaufgeregten Aktionen, die die schönsten Bilder schaffen. Man darf nur nicht den Fehler begehen, sie genau so wiederholen zu wollen.
Ich muss immer wieder bereit sein, unser Leben so zu nehmen wie es eben kommt. Anzunehmen, was ist. Spontan umzudisponieren, wenn alles wieder anders ist. Und mir zwischen all den Ideen, Vorstellungen und Erwartungen Raum zu lassen, dass Soll und Ist zusammenfinden – in den wildesten Ausprägungen. Das nennt man wohl Familienleben.
Und wie stehts’s um eure Frustrationstoleranz in Sachen Soll und Ist?
Alles Liebe,










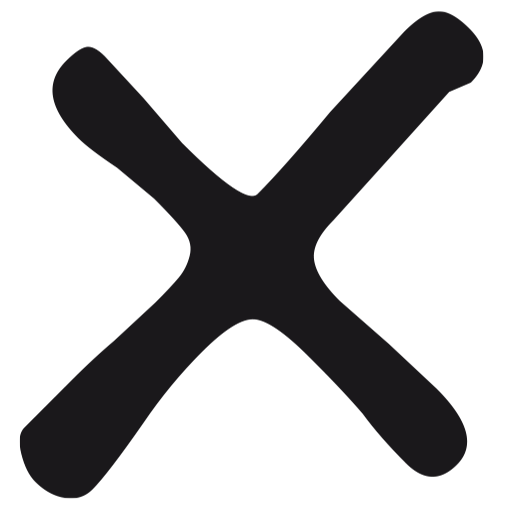
Genau SO!! Ich denke mir am Wochenende immer schöne Sachen für die ganze Familie aus, aber die überschwängliche Dankbarkeit und gute Laune bei unseren 3 Kindern bleibt oft aus:
im Kindertheater war es zu heiß, die Wanderung ist zu lange und nach den Pommes mit Wurst gab es nicht mal noch ein Eis :-(. Oder: statt 3 Kugeln Eis für jeden, gab es NUR 1 Kugel für jeden – dabei ist es doch besser als GAR KEIN EIS!? Da ich momentan schwanger bin, ist meine Toleranzgrenze etwas eingeschränkt, da kann es dann schon einmal krachen.
Aber jedes Wochenende starte ich einen neuen Versuch, aufgeben ist keine Option :-).
Danke für den Schönen Beitrag!!!
Hej liebe Daniela, Dankesformel dein nettes Feedback! 🧡 Nein, aufgeben ist keine Option, nur aushalten lernen, was mit drei (und bei euch bald vier) Krachmachern eine Lebensaufgabe ist 😉 Aber es gibt sie immer wieder, die unerwartet schönen Momente, mit denen man gar nicht mehr rechnet – und die sind es, die einen immer weiter machen lassen. Alles Liebe für dich und deine Bande!
…Es sollte natürlich Danke heißen 😆
Liebe Katia, oh wie ich mich wiederfinde in deinen Beitrag. Wir haben 3 Jungs: 5 jährige Zwillinge und einen fast 8 Jährigen. Meine Traumvorstellung ist auch immer als Familie zusammen Unternehmungen zu machen. Da dies in der “Zivilisation” meist mega stressig ist, gehen wir raus in die Natur, in die Heide, die Wälder im Umland. Da klappt es oft sehr gut mit den dreien, sie beschäftigen sich. Urlaub findet auch grundsätzlich nur noch im Zelt statt, wieder mitten in der Natur, immer der gleiche Campingplatz. Da kennen sie sich aus und die Aufregung hält sich zumindest soweit in Grenzen, dass sie nicht total durchknallen🤪.
Schade eigentlich, dass man die Familie aufteilen muss damit es entspannt läuft. Das habe ich auch neulich schmerzlich erfahren müssen als ich mit den Zwillingen auf Mutter-Kind-Kur war und dann der große mit dem Papa ein Wochenende zu Besuch kam: von entspannt zu unentspannt in 5 Minuten🙈. Aber vielleicht ist das einfach so, wie du sagst: dass alle zusammen irgendwie nicht harmonieren. Was aber auch noch gut läuft, ist wenn es mehr Kinder sind als die eigenen, die dann in einer Horde (wie in meiner Kindheit) durch die Gegend ziehen. Dann macht es durchaus Sinn Ausflüge mit entspannten, vielleicht sogar verwandten Eltern und deren Kindern zu unternehmen.
Alles Gute Dir!
Andrea aus Hannover
Hej liebe Andrea, danke für deine supernette Rückmeldung! 🧡 Ja, am entspanntesten sind wir meist tatsächlich im Pulk mit befreundeten Familien. Wenn wir sie in ihrer Horde die Hackordnung selber regeln
lassen – und wir uns raushalten. Insofern sind wir an den Wochenenden auch sehr gern verabredet 😉Alles Liebe nach Hannover
Liebe Katia,
du schreibst mir mal wieder aus der Seele!
Wir sind auch noch eine Patchworkfamilie mit drei Jungen zwischen 9 und 14.
Meine Rama-Frühstücksfamilien-Vorstellungen müsste ich eigentlich längst über Bord geworfen haben, aber man kann es eben einfach nicht. Und das ist auch gut so! Denn so wie du es schon schreibst: Es entstehen andere tolle Momente, die ich mir nie hätte erträumen können. Auch wenn es nur ganz kleine Momente sind und sie nur so 3 Minuten halten :-), sind es doch genau diese, die einen den ganzen Familienwahnsinn aushalten lassen!
Danke für deine tollen Worte – mal wieder!!!!!!!!!!!
Viele Grüße von Sabrina
Hej Sabrina, ich freu mich über dein supernettes Feedback – und kicher immer noch über die RAMA-Frühstücksfamilie. An die hab ich schon lang nicht mehr gedacht 😉 Ja, manchmal sind es drei Minuten, die den Tag zu einem guten werden lassen und meist kommen sie aus einer völlig unerwarteten Ecke. Aber sie kommen 🙂 Alles Liebe für dich und deine Bande!
Du hast mich abgeholt, Danke!
Grade in den Ferien ist es fast unmöglich die Launen einer 14 jährigen mit dem Bewegungsdrang eines 10 jährigen zu vereinbaren.
Da ertappe ich mich leider wirklich manchmal, mich fast von Social Media blenden zu lassen und zu vermuten, es sei nur bei uns so…
Liebe Grüße
Sandra
Hej Sandra, oha, das glaub ich dir sofort! Hier sind es die präpubertären Launen eines Neunjährigen, die mit den Ideen seiner sechsjährigen Schwester und den Trotzanfällen des Dreijährigen versöhnt werden müssen… Und nein: Es gehe davon aus, dass alle Familien mit dieser Herausforderung zu kämpfen haben. Alles Liebe, genieß die unerwartet schönen Momente zwischendrin
Wie wahr! Ein schöner Bericht, um sich selbst und seine manchmal auch zu hohen Erwartungen wieder zu erden. Danke für den Gedankenanstoß!
Liebe Grüße, Anne
Hej liebe Anne, wie schön, manchmal tut so ein kleiner Stups ja ganz gut 🙂 Alles Liebe!
Genauso und nicht anders! Auch aus der Perspektive einer 34-Jährigen ändert sich da wenig. Ich frage mich, warum meine Mutter immer wieder diese rosaroten Momente herbeisehnt und tue es ihr als zweifache Mutter nun gleich. Wahrscheinlich sollte man sich tatsächlich einfach nur aufteilen und nicht auf happy Family mit kollektiven Erfahrungen hoffen 😉
Hej Julia, ich vermute auch, dass wir nie aufhören werden, nach diesen rosaroten Momenten zu suchen…🙈 Ich versuche es immer wieder nach dem Trial&Error-Prinzip: Einmal alle zusammen, das nächste Mal getrennt – und zwischendrin ist immer mal ein Treffer dabei 😉 Alles Liebe!
Liebe Katia, ein super Text. Vielen Dank dafür!
Ich mag auch viel lieber Programmkino mit ganz unterschiedlichen Facetten und genieße dann die zufällig entstehenden schönen Momente umso mehr.
Ehrlich gesagt plane ich das gedanklich schon mit ein, weiß aber, dass dann immer wieder diese goldenen Momente entstehen, wo ich leise die Kinder beobachte und mich freue, dass es gerade so gut läuft. Klar, die Uhr bis zum nächsten Bruder Streit kann ich stellen. Meine Zwillings-Jungs wollten auf der Autofahrt in unser sehr schönes Kurz Wochenende unentwegt den Song „Brudi“ von deine Freunde hören. Eine warme Empfehlung, um dem Bruder Streit mit Humor zu begegnen und anders würde ich es gar nicht wollen. Sind halt meine coolen Jungs 😻.
Liebe Mathilda, vielen lieben Dank für dein nettes Feedback! 😊Deine Freunde helfen bei uns auch immer gern aus – und sei es, dass wir den Sound im Auto ganz laut aufreißen und alle zusammen „Du bist aber groß geworden“ hrölen. Dann herrscht immerhin für fünf Minuten zwischendurch Einigkeit 😉Alles Liebe!
Liebe Katia,
meine beiden Jungs sind mittlerweile 11 und fast 16. Da gehen die Interessen natürlich weit auseinander. Schon immer. Wenn ich mit beiden zusammen etwas geplant habe, lief das selten gut. Aber ich habe es trotzdem immer wieder mal probiert und manchmal klappt(e) es dann… Dann habe ich mich umso mehr gefreut. Es ist mittlerweile auch selten, dass wir am Wochenende mal zusammen Frühstücken. Gemeinsames Essen artet jedesmal in Bruderstreit aus, bei dem dann einer beleidigt abzieht. Oder ich ergreifen die Flucht und kurz drauf sitzen die beiden einträchtig zusammen. Ich glaube mittlerweile dass man nicht mit so hohen Erwartungen an solche Planungen gehen sollte. Meistens plane ich spontan und frage die Jungs, ob sie mitkommen wollen. Wenn ja, freue ich mich. Wenn nicht ist auch gut. Für mich zählen die (meist) spontanen Momente, wo wir zusammen Spaß haben.
Hej liebe Angelika, der Ansatz gefällt mir auch: Die spontanen Momente genießen, wo und wenn sie entstehen – und dem Rest nicht so viel Gewicht geben. Und vielleicht sollte man sich genau das als Kleinkindmutter vor Augen halten: Die Momente des Zusammenseins nehmen im Laufe der Jahre rapide ab – insofern ist auch mittelprächtiges Miteinander gut (zumindest in der Rückschau 😉 Alles Liebe!
DANKE ❤️ Dein wunderbarer Text kam genau im richtigen Moment für mich. Vorpubertierende 9jährige Zwillingsmädels plus energiegelader 6jähriger Bruder. Beide Eltern arbeiten Vollzeit. Oft genug am Rande des Wahnsinns und dann immer wieder- kleine kostbare Sternmomente in unterschiedlichen Konstellationen, denen ich versuche viel mehr Gewicht, als den Gewitterwolken zu geben. Nicht immer leicht, aber wissend- es lohnt sich 😉 Und jetzt mach ich den Dreien die Glotze an und mir einen Weißwein auf. Schönes Wochenende und viele kleine unerwartete Glücksmomente dir 😄
Cheers, liebe Kerstin! 🙂 Glotze an und Weißwein ist ein probates Mittel, um dem Irrsinn zwischendurch eine andere Note zu verleihen 😉 Und ich häng an deinem Satz: “…und dann immer wieder- kleine kostbare Sternmomente in unterschiedlichen Konstellationen, denen ich versuche viel mehr Gewicht, als den Gewitterwolken zu geben.” Das ist genau meine schwierigste Übung. Alles Liebe!
Familienwahnsinn… dieses Wort geht mir auch oft durch den Kopf, v.a. nach gemeinsamen Mahlzeiten (einen köstlich-treffenden Beitrag habt ihr ja kürzlich veröffentlicht ;-)) Mehr noch: der Alltagswahnsinn. Für uns sind die Wochenenden am erholsamsten, wenn wir einfach laufen lassen. Keine Termine, keine Planung, vielleicht erlebt jeder von uns 4 etwas Anderes, hat Freiraum, Auszeit. Unsere Tochter mit der besten Freundin, unser Sohn bei der Oma auf dem Bauernhof, der Papa geht radeln und Mama hat Kreativzeit im Nähzimmer. Die ganze Woche hetzen wir den Verpflichtungen nach, müssen in sozialen Gruppen funktionieren, uns in der Schule, Kita, im Job unterordnen, die Uhr immer im Blick. Warum auch noch am Wochenende? Bei uns funktioniert Familiengefühl auch, wenn wir keine gemeinsamen Unternehmungen machen, weil wir wissen, dass wir zusammengehören – wir sind nicht tiefer verbunden durch idyllische Ausflüge, sondern durch den Freiraum, den jedes Familienmitglied erhält. Vielleicht hilft euch das beim Loslassen von rosaroten Familien-Wochenend-Vorstellungen und verringert den Frust? Auch sich zu fragen: Was ist das Ziel einer Familienunternehmung? Dass die Eltern sich vom Job erholen? Dann plant lieber öfter ein We als Paar! Die Kinder sehen ihre Welt mit ihren Augen, ganz klar, dass sie nicht immer eure Vorstellungen teilen. Alles Liebe, Nicole
Hej liebe Nicole, ganz lieben Dank für deine spannenden Gedanken zum Thema Familienwahnsinn 🙂 Besonders gefallen hat mir euer Ansatz, dass für ein Zusammengehörigkeitsgefühl nicht zwingend gemeinsam etwas unternommen werden muss, sondern dass die innere Verbundenheit auch im losen Verbund entsteht. Alles Liebe!
Liebe Katia,
wieder einmal sprichst du mir aus der Seele – wir sind im Familienurlaub und die Schere zwischen Soll und Ist ist riesig. Ich wollte in diesem Urlaub endlich gesund werden und stattdessen husten 4 von 5 Familienmitgliedern (inklusive mir) und die Entspannung lässt auf sich warten… Und auf das Schwimmen im See, auf das ich mich so gefreut habe,muss ich auch verzichten…
So geht es nun darum andere Lösungen zu finden und für das, was wir haben, dankbar zu sein. Und das fällt leichter, wenn ich so einen guten Text von dir lese!
Herzliche Grüße,
Luise
Hej liebe Luise, oh verdammt – so einen Urlaub hatten wir auch just – und ich fand es gar nicht so einfach, mich darauf einzulassen, dass es alles so ANDERS war als gehofft. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr schnell wieder auf die beine kommt, es trotzdem irgendwie genießen könnt – und du noch zu deinem See-Bad kommst! 🙂 Alles Liebe, ich danke dir sehr für deine lieben Worte, Katia
Deine Zeilen lese ich heute nicht zum ersten Mal und jedes Mal rührt es mich wieder zu Tränen da in diesem Moment wieder mal alles von den Schultern abfällt – Viiiielen Dank für deine ehrlichen Worte.
Hej liebe Mary, witzig, dass du das gerade schreibst – ich hatte heute morgen auch wieder so einen Soll-Ist-Moment… 😉 Courage und mit Humor nehmen, das sage ich mir selbst gerade wieder. Dennoch ein schönes Wochenende, alles Libe, Katia