Als wir vor drei Jahren unser Haus bauten, fragten wir meinen Vater, ob wir ein Zimmer für ihn einplanen sollten. Für irgendwann, wenn er mal nicht mehr so kann, wie er will. Für den Fall, dass er irgendwann Hilfe braucht. Für den Fall, dass er Pflege braucht. Allein das Wort auszusprechen war seltsam. Und die Gedanken dazu noch schräger – für mich UND für ihn. Wer stellt sich schon gern vor, dass die eigenen Eltern, diese Felsen in der Brandung des Lebens, irgendwann bettlägerig sein könnten? Und wer malt sich schon gern den Ausklang des eigenen Lebens aus…?

Mein Vater murmelte damals etwas von, er würde darüber nachdenken und noch mal Bescheid geben. Und dann haben wir nie wieder darüber gesprochen. Erleichtert, dieses schwierige Thema meiden zu können. Es zu verdrängen, wie man schwierige Themen gern verdrängt, so lange sie nicht den unmittelbaren Alltag betreffen. Und gleichzeitig mit schlechtem Gewissen, weil: Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem das Thema akut wird. Mitunter schneller, als einem lieb ist. Und dann ist man eigentlich besser darauf vorbereitet.
Wann ist der passende Zeitpunkt, mit den Eltern übers Altern zu sprechen?
Darüber, wie sich ihren Lebensabend vorstellen? Schon lange bevor es ansteht – oder erst, wenn Handlungsbedarf besteht? Denn es geht um so viel mehr als um vorausschauende Planung. Es geht darum, sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen. Sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, irgendwann keine elterlichen Ratgeber, Fürsprecher, keine Mutter und keinen Vater mehr zu haben. Es geht darum, anzuerkennen, dass man so erwachsen ist, dass sich die Kraftverhältnisse zwischen Eltern und Kindern verschieben, manchmal unmerklich – und manchmal auf einen Schlag, buchstäblich. Und das ist ziemlich aufreibend.
Ich denke gerade häufiger an meine Großmutter zurück. Sie lebte in der oberen Etage meines Elternhauses, das vorher ihr Haus war. Meine gesamte Kindheit hindurch war sie da – brachte meine Schwester zur Kita und holte sie wieder ab, las uns Kindern stundenlang vor, versorgte uns mit Snacks Geschichten, ihrer Gesellschaft.
Sie hatte eine Aufgabe – bis sie nach einem Sturz bettlägerig wurde und sich nicht mehr um uns kümmern konnte.
Jetzt war es an uns, dass wir uns um sie sorgten, ganz selbstverständlich. Soweit ich weiß, stand es nie zur Debatte, dass sie in ein Heim umziehen sollte. Dass wir es jemand anderem überlassen wollten, sie zu pflegen. Und so verbrachte sie die letzten Monate ihres Lebens in ihrem Schlafzimmer, von uns mit Snacks, Geschichten und Gesellschaft versorgt. Wir sahen dabei zu, wie sie immer weniger wurde, immer weniger Teil dieser Welt war.
Ich fand es nicht schlimm – bis zu dem Tag, als ich allein mit ihr zuhause war und sie einen Erstickungsanfall hatte. Ich war 13 und in Panik, aber immerhin so geistesgegenwärtig, die Nummer ihres Hausarztes zu wählen, der die Rettung rief. Sie starb zwei Tage darauf im Krankenhaus. Auch wenn ich es richtig fand, sie bis zum Schluss bei uns zu behalten: Seitdem habe ich eine Ahnung davon, was es auch psychisch heißt, die eigenen Angehörigen zu pflegen. Ihnen zur Seite zu stehen, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie nicht mehr wollen. Das muss man auch aushalten können. Das muss man wirklich wollen.
Und doch scheint diese Idee der Großfamilie, die sich in allen Lebenslagen gegenseitig stützt, immer noch eine schöne.
Dass niemand allein ist, in guten und auch in schlechteren Tagen nicht. In unserem Freundeskreis sind bereits einige Eltern in letzter Zeit ihren erwachsenen Kindern, ihren Enkelkindern hinterhergezogen, teilweise durchs halbe Land. Haben im Alter noch einmal mutig Wohnort und Lebenstrott verändert, um näher bei der Familie zu sein. Um einen gemeinsamen Alltag zu teilen und nicht nur die obligatorischen Festtage. Mit dem Gedanken, jetzt ihre Familien mit kleineren Kindern, so gut es eben geht, zu unterstützen. Und vielleicht irgendwann in der Zukunft selbst gestützt zu werden, wenn die Kraft nicht mehr für viele und vielleicht auch nicht mehr für sie selber reicht.
Nun ist es ja so, dass die meisten Menschen räumlich gar nicht die Möglichkeit haben, ihre Eltern im Alter aufzunehmen.
Für den Großteil wird ein Heimplatz oft die einzige Möglichkeit sein, auch wenn die Vorstellung nicht eben angenehm ist. Mein Vater hat mir irgendwann einmal gesagt: “Bevor ich ins Heim gehe, erschieß ich mich lieber!” Nicht, dass ich das wirklich glauben würde. Aber ich weiß zumindest, dass das für ihn die schlimmste Vorstellung ist, wie er sein Lebensende verbringt. Insofern braucht es andere Ideen – in unserem Haus ist jetzt kein Zimmer vorgesehen. Wir müssten wohl mal wieder darüber sprechen.
Aber darüber zu sprechen heißt eben auch, dem anderen seine Stärke, seine Selbstwirksamkeit abzusprechen – selbst wenn all das noch in der Zukunft liegt. “Altern ist nichts für Feiglinge”, heißt es. Und ich glaube, da ist so viel mehr dran, als die Schnoddrigkeit dieser Aussage. Denn es braucht wirklich Mut, sich diesen Gedanken zu stellen – für die Kinder und die Eltern. Es braucht Fantasie, um sich mögliche Szenarien auszumalen, was passieren kann, was realistisch ist, für alle Beteiligten – finanziell, zeitlich, konstitutionell. Und will man sich das Ende so detailliert vorstellen? Eher nicht.
Bevor meine Mutter nach langer Krankheit starb, wusste ich, wie sie sich ihr Ende vorstellte.
Wie sie beerdigt werden wollte, wie ihre Trauerfeier sein sollte (hier habe ich schon einmal über sie, ihren Tod und meine Trauer geschrieben). Und es hat uns als Familie später sehr geholfen, dass wir uns etwas halten konnte, das in ihrem Sinne war: Viel Farbe statt Schwarz, bloß keine Gerbera in den Trauergestecken und statt eines tristen Leichenschmauses ein Erinnerungsfest mit allen Freunden.
Insofern möchte ich eigentlich doch gern wissen, was mein Vater sich für sein Alter wünscht. Für den Fall, dass er es mir irgendwann nicht mehr sagen kann – dann will ich nach seinem Willen handeln können: Ist es die häusliche Pflege in seiner vertrauten Umgebung? Oder doch vielleicht bei uns – wir könnten Platz schaffen, wenn er es wollte (und wir dann auch). Denn es hilft einem in emotionalen Ausnahmezuständen enorm, wenn man nicht haltlos in Optionen schwimmt.
So schwer es auch ist: Ich finde den Dialog – auch den inneren – dennoch gerade gut.
Weil er mir bewusst macht, dass mein Vater und ich jetzt noch eine Beziehung auf Augenhöhe haben. Eine, in der mein Vater mein eigenständiger Vater ist und ich seine erwachsene Tochter. Eine Beziehung, in der sich die Kräftefelder zwar manchmal minimal verschieben, aber noch weitestgehend intakt sind.
Es macht mir bewusst, dass wir diese gute Zeit gerade unbedingt nutzen sollten für all das Schöne, das wir gern teilen – gutes Essen, Anekdoten, Familienzeit. Und ich hoffe inständig, dass diese Zeit noch lange geht. Und dass wir darin den passenden Zeitpunkt finden, die wichtigsten Punkte für später kurz zu klären. Danach können wir das Thema auch gern wieder beiseiteschieben…
Wie ist es bei euch: Sprecht ihr mit euren Eltern über das Alter, gibt es Pläne? Oder pflegt ihr vielleicht bereits Angehörige?
Alles Liebe,








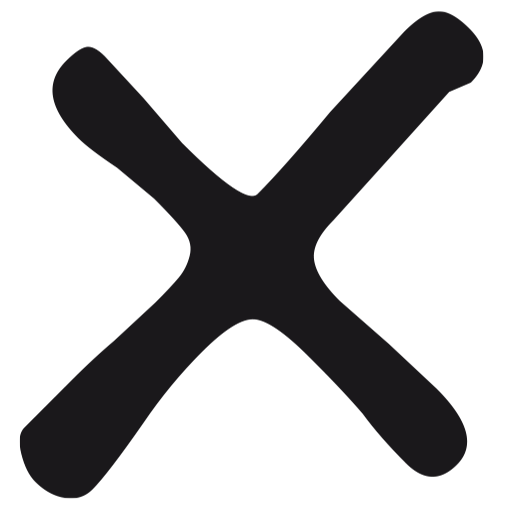
Sehr wichtiges, aber such schwieriges und vor allem emotionales Thema. Meine Mama hat sich immer sehr gewünscht, bei meinen Großeltern anzubauen, im genau das zu haben. Hilfe mit den Kindern und später räumliche Nähe zu den pflegebedürftigen Eltern. Meine Großeltern wollten das nicht. Inzwischen sind sie alt, pflegebedürftig und einsam. Sie schaffen es mit der Hilfe des Pflegedienstes und ihrer Kinder und Enkel (wohnen alle 15 Minuten entfernt) noch alleine zu Hause zu leben, aber es hätte so viel einfacher sein können…
Meine Eltern wohnen fußläufig 10 Minuten von uns entfernt. Sie sind jetzt 63 und 69 und hoffen, lange in ihrer Wohnung bleiben zu können. In unserem Haus müsste man viel umbauen, um sie im Alter zu uns zu holen. Allerdings haben wir direkt nebenan eine Eigentumswohnung, die wir relativ einfach altengerecht umbauen könnten, das ist auf jeden Fall eine Option für später. Wenn meine Eltern das möchten.
Wenn eines unserer Kinder später bei uns anbauen möchte, wären wir dafür auf jeden Fall offen.
Vieles war einfacher, als mehrere Generationen zusammen gelebt haben. Wichtig sind allerdings klare Grenzen.
Hej liebe Andrea, ja, mir brannte das Thema auch schon lange auf den Nägeln – und ich habe mich ebenso lange nicht rangetraut. Eben WEIL es so emotional ist. Aber ich glaube, wir tun uns alle einen Gefallen, wenn wir das halbwegs rechtzeitig durchdenken und mögliche Schritte einleiten. Ja, dieses Generationen-Modell hat schon viel für sich, aber ist auch nicht ohne emotionale Belastung. Es kommt ja auch immer auf die Unterbringungsmöglichkeiten drauf an, die jede Familie ganz individuell schaffen kann. Danke dir für deinen Einblick und dass du hier bei WASFÜRMICH mit an Bord bist! Alles Liebe, Katia
Mein Vater ist letzten August überraschend verstorben. Nun wohnt meine Mutter alleine in einem viel zu großen Haus, 15 Kilometer entfernt von mir. Sie ist mit den Dingen alleine, um die sich mein Vater gekümmert hat: Garten, kochen, Finanzen, alles schriftliche………………
Ich bin selbst momentan mit 4 Kindern, altem Haus, Garten ec. total gefordert. Ständig mache ich mir Gedanken, wie es ihr geht und habe Angst, wenn sie ganze alleine im Haus ist, vorallem nachts. Ich habe mit Ihr gesprochen, ob sie nicht das Haus verkaufen will und sich verkleinern möchte, aber darüber nachzudenken macht meiner Mutter Mühe. Meine ältere Schwester lebt bei Ihr am Ort, aber es ist schwierig mit ihr…also meiner Schwester…… Solange meine Mutter gesund und fit ist, soll sie es einfach so machen, wie es ihr guttut und sie es möchte. Im Haus sind halt auch die ganzen Erinnerungen an meinen Vater. Falls es irgendwann nicht mehr gehen würde für meine Mutter, würde ich mit Ihr eine Lösung suchen. Unser Haus ist sehr klein, für uns 6 ist es schon oft eng, aber irgendwie wird es gehen, sich um meine Mutter zu kümmern…….Hoffen wir, dass sie noch lange fit bleibt!!!! Grüße an Dich 🙂
Hej liebe Daniela, oh, das kommt mir alles sehr bekannt vor… Mein Vater lebt seit dem Tod meiner Mutter allein in unserem großen Familienhaus. Ich kenne die Ängste sehr gut: Was, wenn er mal stürzt? Wir versuchen uns seit geraumer Zeit über einen Notfallknopf zu verständigen, aber zu einem Ergebnis sind wir immer noch nicht gekommen. Aber ich denke auch: Solange die Eltern noch fit sind – physisch wie psychisch – ist es ihr Leben, über das sie allein bestimmen können und sollen. Ich möchte mich auch nicht zu sehr einmischen, das fühlt sich mitunter ein wenig entmündigend an. Insofern drücke ich auch einfach immer fest die Daumen, dass es noch lange so gut geht. Alles Liebe für euch, Katia
Liebe Katia,
wieder könnte dein Text nicht passender sein… Während wir noch fröhlich Geburtstag und Ferienbeginn gefeiert haben, erlitt meine Mutter am Wochenende einen Schlaganfall… Sehr viel Glück im Unglück trug dazu bei, dass es ihr schon wieder ‘gut’ geht… Es gibt nur wenige Einschränkungen und die Ursache ist noch unklar… Und Zack sind sie alle da, die Gedanken die wir seit Jahren immer erfolgreich wegschieben… Was, wenn es nochmal passiert? Was, wenn sie nicht selber den Krankenwagen rufen kann? Was, wenn sie Pflege braucht? Oder es plötzlich ohne sie weiter geht? So viele offene Fragen, so viele Ängste, so viel Ungewissheit… Und mitten drin wirkt sie plötzlich aufgeräumt und kann sagen was sie möchte und was nicht. Wie ihre Beerdigung sein soll und wo alle wichtigen Papiere sind. Es fällt mir schwer zuzuhören, aber ich muss… Wir müssen! und dann müssen wir dankbar sein und nach vorne schauen! Ostern wird ruhiger als geplant, aber sie wird bei uns sein und wir werden es genießen!
Alles Gute für dich und ein gemütliches Osterfest! Jenni
Hej liebe Jenni, oh, was für ein Schreck!! Und wie gut, dass es diesmal so glimpflich abgelaufen ist. Manchmal braucht es solch einen Warnschuss vielleicht auch, um sich bewusst zu machen, wie kostbar die Zeit ist – und auch wie wichtig, essenzielle Dinge zu regeln, bevor es zu spät ist. Ich wünsche euch von Herzen ein ruhiges osterfest im Familienkreis, alles Liebe, Katia
Ich hatte immer schon “alte” Eltern, da mich meine Eltern mit Anfang 40 noch bekommen haben. Meine vier Geschwister sind alle über 10 Jahre älter. Mein Vater kränkelte schon seit er mitte 60 war, immer mal wieder auch sehr schlimm und lebensbedrohlich. 3 meiner Geschwister lebten vor Ort und in der Nähe, ich am Ende in Bremen. Je älter meine Eltern wurden, desto wichtiger war es mir, Zeit mit ihnen zu verbringen. So traf ich, wenn ich in der Heimat war, auch nur selten Freunde, sondern saß bei meinen Eltern, die auch immer viel Besuch bekamen. Immer begleitete mich bei der Abfahrt das schlechte Gewissen und die Angst, ich könnte sie zum letzten Mal gesehen haben. Sie ergänzten sich gut und haben es in ihrem kleinen Häuschen zusammen geschafft. Mein Vater verstarb dann doch für uns plötzlich Weihnachten 2016 mit 80 Jahren. Da war ich 39 Jahre alt. Meine Mutter schaffte es noch ein Jahr ohne ihn. Ihre Demenz , die sonst durch meinen Vater aufgefangen wurde, war groß, sie konnte nicht mehr alleine leben und kam in ein Heim, da die Geschwister vor Ort auch keine bessere Lösung hatten. Das hat meine Mutter nicht gut verkraftet, man konnte ihr beim Sterben zuschauen. Die letzten drei Wochen habe ich sie noch gepflegt in ihrem Haus. Sie starb Anfang Januar 2018 mit 83 Jahren.
Ich selber habe leider keine Kinder, habe mir aber vorgenommen, schriftlich alles festzulegen. Patientenverfügung ist fertig, Entwurf vom Testament auch. Und auch, wie meine Beerdigung ablaufen soll. Es ist wichtig, alles zu klären, so lange man noch kann. Auch wenn es schwierig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also danke für Deinen Text, liebe Katia!
Hej liebe Almuth, ich kenne dieses Gefühl, dass man bewusst sehr viel Zeit mit den Eltern verbringen möchte gut: Ich hatte schon immer ein enges Verhältnis zu meinen Eltern, aber bevor meine Mutter nach langer Krankheit starb, habe ich so als möglich Zeit mit ihr verbracht – weil ich wusste, sie kommt nie wieder. Ich glaube auch, dass es besser ist, die Dinge zu regeln, bevor sie akut werden, aber es ist meist vn viel Überwindung geprägt. Chapeau, dass du all das schon so frühzeitig auf den Weg bringst! Alles Liebe – und ganz lieben Dank, dass du deine Geschichte hier erzählst, Katia
Darüber sprechen. Fragen stellen und nach Antworten suchen. Es sind grosse Themen. Wir stecken auch mittendrin. Mein Schwiegervater, dem die Welt langsam entschwindet, die Schwiegermutter zur Kur in den Bergen. Wie wird der Alltag, wenn sie wieder zu Hause ist. Wieviel Hilfe wollen sie annehmen? Kompliziert und schwer, wenn sie nicht darüber sprechen, was die Bedürfnisse sind. Wenn sie selber sich nicht eingestehen können, was ist und was geht. Es stockt, weil sich die Themen nicht einfach vom Tisch wischen lassen. Es schmerzt. Und es wäre einfacher, wenn sich darüber sprechen liesse. Ich glaube auch, dass es nicht allen Menschen gleich schwer fällt, mit den Veränderungen umzugehen. Wer zeitlebends immer wusste, was gut und richtig war, haddert noch mal ein gutes Stück mehr mit den Veränderungen.
Ein Prozess, ein Weg mit Zwischenhalten, mit Abzweigungen. Und doch Schönes am Wegrand. Nicht zu vergessen 🙂
Hej liebe Veronica, es ist meistens ein Prozess, weil das Thema oft lange, lange vor sich hergeschoben wird. Ich kann verstehen, dass das bei euch gerade auf allen Seiten große Unsicherheiten hervorruft. Wenn man sie hat, muss man dem Zeit geben und auch ein wenig hoffen, dass es sich fügt. Und den Mut aufbringen, zur richtigen Zeit das Gespräch zu suchen. Ich wünsche euch alles Liebe dabei, Katia
Meine Mutter ist Ende September des letzten Jahres im Alter von 88 Jahren verstorben. Ein halbes Jahr vorher musste sie nach einem Sturz (ihre Beine trugen sie auf einmal gar nicht mehr) in ein Heim. Das war für uns alle sehr schwer, aber eine Pflege zuhause (wir wohnen im eigenen Zweifamilienhaus – sie wohnte unten, wir nebenan oben und unten) konnten wir nicht leisten. Nach einiger Zeit hat sie sich aber in dem Heim wohlgefühlt – es war ja schließlich immer etwas los und sie war dankbar dafür, dass sie immerhin 88 Jahre in ihrem eigenen Zuhause selbständig (mit unserer Hilfe) leben konnte. Leider kam dann eine Gallenop, für die ihr Körper keine Kraft mehr hatte und sie hat sich selber gegen die erforderlich werdenden Dialysen entschieden um zu sterben.
Wir 2 sind inzwischen 68 und 64 Jahre alt – es ist wirklich schwierig sich zu entscheiden, wie und wo man die nächste Zeit verbringt!
Hej liebe Frauke, es ist auf beiden Seiten nicht leicht, das merke ich auch immer wieder. Als derjenige, der der Endlichkeit näher ist zu entscheiden, wie die letzte Zeit gestaltet werden soll – und als Angehörige das mit zu tragen – und auch zu ertragen. Aber wenn man sich dazu durchringt, ordnet es die Dinge, und ich finde, das ist am Ende doch immer das bessere Gefühl. Danke für deine Offenheit hier, alles Liebe, Katia
Liebe Katja,
herzlichen Dank für deinen Text und die wichtigen Gedanken, die du damit anstößt. Es fühlt sich so viel besser an, wenn man darüber spricht.
Es ist bewundernswert, wenn man die Eltern pflegen kann. Aber man muss die Zeit und die Kraft haben.
Als meine älteste Tochter ein halbes Jahr alt war, habe ich meinen Vater drei Wochen gepflegt. Meine Tochter hab ich nur zum Stillen gesehen, sonst musste mein Mann sie versorgen. Es war klar, so geht das nicht.
Jetzt lebt er seit 10 Jahren im Pflegeheim. Ich hab noch lange damit gehadert.
Wir besuchen ihn oft.
Liebe Grüße und danke!
Hej, ich freu mich immer sehr, wenn ihr aus Themen, die mich gerade umtreiben, auch etwas ziehen könnt! 🙂 Selbst wenn es sich um solche handelt, die nicht ganz einfach sind… Deine Geschichte klingt nach einer sehr anstrengenden und beleuchtet klar den Aspekt, wie aufreibend es ist, Angehörige selbst zu versorgen. Denn auch das wird mitunter vielleicht ein wenig romantisiert. Ich freu mich, dass ihr eine für euch gangbare Lösung gefunden habt! Alles Liebe, Katia
Heute erst wieder meinen Vater gesehen- 83 Jahre und 500 km weit weg, meine Mutter seit über zehn Jahren verstorben. Ich ein Einzelkind, mit selber vier Kindern und krankem Mann. Das schlechte Gewissen ist ständig da, aber er ist erwachsen und blockt alle Gespräche über die Zukunft ab. Das finde ich furchtbar schwierig!
Hej liebe Annie, das klingt in der Konstellation tatsächlich sehr schwierig! Manchmal denke ich: steter Tropfen und so. Vielleicht ist eben doch irgendwann der richtige Zeitpunkt, aber man muss sich selbst immer furchtbar dazu aufraffen. Kenne ich zu gut… Alles Liebe für euch, Katia