War mein Körper irgendwann einfach nur mein Körper? Vermutlich als Kind. Wo ich ihn ohne Vorurteile, ohne Vergleiche einfach als mein Zuhause betrachtet habe. Es ist gar nicht mal so, dass ich mich in meinem Körper später richtig unwohl gefühlt hätte: Ich war immer groß, schlank, sportlich, eher muskulös als filigran. Normschön, normschlank, würde man heute sagen. Und doch: Seit Teenie-Tagen bin ich mir seiner immer bewusst: Er IST für mich nie nur, er hat immer einen Zusatz: Ist an manchen Stellen zu viel, an anderen zu wenig, ist mir immer präsent. Nie einfach nur da, nie gänzlich frei.

Auch meine Gedanken sind es nicht: Nicht frei von den Bildern, wie mein Körper auszusehen hat. Und gleichzeitig nicht frei von der Scham, solche Gedanken überhaupt zu denken. Da will, da muss ich doch drüberstehen als Frau, die sich ansonsten meist als Feministin fühlt. Und doch befasse ich mich immer wieder mit mir und meinem Körper. Was im Laufe des Lebens nicht einfacher wird, weil ich relativ machtlos der Vergänglichkeit von straffer Haut und der Umverteilung von Körpermasse beiwohne. Dabei schaue ich nie so auf andere. So streng. So wertend.
Auch die Kinder haben an meiner Körperwahrnehmung nicht groß etwas geändert.
Ich war einfach sehr dankbar, dass die drei Schwangerschaften keine Krater in die Landkarte meiner Haut gerissen haben, dass ich jedes Mal relativ schnell meine Figur von vor den Schwangerschaften wieder hatte. Aber spurlos geht kein Kind an einem vorüber, zumal, wenn man wie ich erst ab 35 mit der Familienwerdung losgelegt hat.
Und so brachte ich es fertig, auf meinen Körper unfassbar stolz zu sein, dass er diese drei Wesen in sich beherbergt und gut in die Welt gebracht hat – um im nächsten Moment kritisch meine Oberschenkel zu beäugen und mich zu fragen, ob die Dellen jetzt wohl für immer dableiben würden.
Sagen wir mal so: Ich kann mit meinen Dellen leben – aber ich muss sie nicht dringend zur Schau stellen. Zum Beispiel im Bikini. Genauer: Im Bikini im Schwimmbad.
Was eine Schwierigkeit darstellt, wenn man drei Kinder hat, die erklärte Wasserratten sind und als liebste Freizeitbeschäftigung unisono “Schwimmen gehen” nennen. Und einen Mann, der in Sachen Schwimmbad ähnlich abwehrend ist wie man selbst – wenn auch aus banaleren Gründen (“Laaangweilig!”).
Und so habe ich mich die letzten Jahre höchstens zwei Mal pro Saison zu einem Schwimmbad-Besuch überreden lassen, den ich möglich kurzhielt und gern im Bademantel am Beckenrand verbrachte. Bis zu diesem Jahr, das etwas Neues in Gang gebracht hat.
Es hatte mit meiner Sehnsucht nach Sommer zu tun. Danach, Sommerdinge zu machen, so viele als möglich.
Der Winter war doof und voll leidiger Corona-Themen und ich wollte nichts lieber als raus. Raus an die frische Luft, raus aus der Tristesse, raus aus den Klamotten. Mein Trio wollte ins Freibad. Und irgendwie dachte ich plötzlich: “Ist doch egal.” Ich hatte die Nase voll davon, mir Gedanken um meinen Körper zu machen, darüber, was ich von ihm halte, was andere von ihm denken mochten.
Ich wollte lieber Dinge mit diesem Körper spüren. Das Gefühl, das erste Mal wieder in kaltes, klares Wasser zu tauche. Das Gefühl, wie die Tropfen auf der nackten Haut von der Sonne zusammengeschmolzen werden. Das Gefühl, meine bloßen Beine von einem Steg ins Wasser baumeln zu lassen. Und auch das prickelnde Gefühl, zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder vom Dreier zu springen – und kreischend und prustend durch die Wasseroberfläche zu stoßen. Was ich dabei für eine Bikini-Figur machte? Plötzlich nebensächlich.
Vielleicht ist es diese Art von Demokratie, die im Freibad herrscht: Alle sind mehr oder unbekleidet. Ohne die Schutzschicht ihrer Klamotten.
Im Freibad sind Große und Kleine, Dicke und Dünne, Alte und Junge, mit Falten, Narben, Prothesen. Rentnerinnen, die sich zum gemeinsamen Morgenbad treffen. Teenies, die ihre besten Arschbomben präsentieren. Mütter mit Kindern, Homeoffice-Flüchtlinge – und niemand scheint sich darum zu scheren, dass alle hier vergleichbar sind, in all ihren ungeschönten Details. Das hat etwas so Befreiendes, wie ich es an diesem Ort nie vermutet hätte.
Es lebt bestimmt von der Wiederholung. Es wieder und wieder zu tun, bis es keine Besonderheit mehr ist, sich erst in seinen Badeanzug – und bald darauf in seinen Bikini zu schälen: Mein weicher Bauch war mir schon lange nicht mehr so gleichgültig wie auf einmal im Freibad. Wieder und wieder ganze Nachmittage halbnackt zwischen anderen Menschen rumzulaufen, mit den Kindern zu schwimmen, zu rutschen, zu springen, Pommes zu essen, die Sonne zu genießen. Mitunter bin ich morgens allein zum Schwimmen ins Freibad gedüst – und nachmittags noch einmal mit den Kindern. Um mich zu fühlen, um zu fühlen, dass ein Körper einfach ein Körper ist. Nicht mehr – und nicht weniger.
Mein Freibad-Sommer hat etwas mit mir gemacht.
Damit, wie ich auf mich schaue. Wie ich über mich denke. Ich habe etwas ziehen lassen. Und etwas gewonnen. Eine Freiheit, die ich schon lange nicht mehr kannte. Vielleicht nähert man sich im Alter doch wieder dem Kindsein ein. Und sei es nur mit dieser mir-doch-egal-Haltung. Ich übe jetzt übrigens im Hallenbad weiter. Am liebsten in einem mit ganz vielen Rutschen – für ganz viel gute Achterbahn-Gefühle statt strudelnder Gedanken.
Mögt ihr euch gern im Badeanzug zeigen?
Alles Liebe,








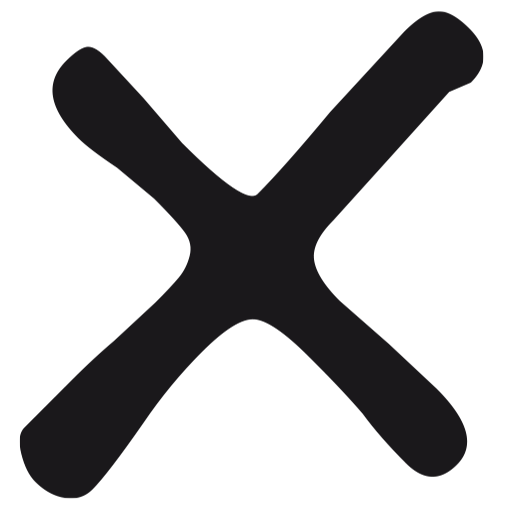
Gut gemacht !❤️
Hej liebe Eva, danke – fühlt sich auch so an 😉🧡. Alles Liebe, Katia
Hallo Katja,
habe den Artikel jetzt erst gelesen und mir ging es ähnlich wie Dir – lange habe ich gehadert, ob ich mich im Freibad oder am Strand im Bikini zeigen soll. Bis ich gemerkt habe: hier sind ja auch nur Menschen. Und im Vergleich mit anderen – den man unweigerlich macht – habe ich dann doch plötzlich selbst für meine kritischen Augen gar nicht so schlecht abgeschnitten. Und gemerkt; die positiven und schönen Momente überwiegen eindeutig! Und das Kind erinnert sich sicher nicht an dellige Oberschenkel oder Mama mit Bauch, sondern nur daran, wie schön die gemeinsame Zeit dort war! Und wie toll es ist, dass Mama mit im Wasser geplanscht hat und am Strand auch im Bikini Strandtennis gespielt hat und Bällen hinterherläuft, ohne an die Figur zu denken.
Macht auch selber plötzlich viel mehr Spaß, wenn man den Kopf ausschaltet und nur noch die Sonne, das Salz, den Wind auf der Haut spürt…
Und ganz ehrlich: haben uns nicht gerade das diese blöde Corona-Zeit und all die anderen Katastrophen da draußen gezeigt: Scheiß drauf!! Es gibt so viel Wichtigeres – lasst uns das Leben genießen!!
Hej liebe Susanne, wie schön, dass du diese (heilsame) Erfahrung auch gemacht hast. 🙂 Tut verdammt gut, sich von dieser doofen Eitelkeit zu lösen, oder? Ich bin komplett bei dir: Es ist definitiv die Mutter präsenter, die sich ohne Wenn und Aber mit ins Getümmel stürzt als die, die sich irgendwo unterm Badehandtuch versteckt! Und ich unterschreibe jedes deiner Worte im letzten Absatz: Lass uns das Leben genießen! Und das geht oft so viel besser, wenn man den Kopf ausschaltet. 🙂 Danke für dein nettes Feedback! Alles Liebe, auf bald im Schwimmbad 😉