Alles hat einen Anfang und ein Ende. Die Jahreszeiten. Das Leben. Es ist der Lauf der Dinge, wir alle wissen das. Aber wollen wir das wirklich wissen? Die Antwort lautet zumeist nein. Niemand denkt gern darüber nach, dass er nicht unsterblich ist. Doch manche Zeiten zwingen einen dazu, und eine weltweite Pandemie ist wohl so ein Zeitpunkt. Gerade rückt der Tod ein Stück näher als zuvor. Und er scheint nicht nur ein neuer Gedankengefährte der Erwachsenen zu sein: Auch meine Kinder beschäftigt das Thema gerade mehr als sonst. Und so habe ich beschlossen, ein wenig genauer hinzuschauen. Für mich. Für sie. Mit ihnen. Und festgestellt: Das kann sogar ganz schön sein…

In unserer Familie haben wir das Glück, dass der Tod gerade nur ein Gedankenspiel ist: Unsere Großeltern sind gesund und munter, unsere Freunde und wir ebenfalls. Aber Covid ist einfach nicht mehr wegzudenken, auch für die Kinder nicht. “Oma und Opa sind ja schon ganz schön alt – müssen sie jetzt bald an Corona sterben?”, fragte meine Tochter kürzlich.
Ich habe ihr erklärt, dass Alter nicht zwingend heißt, dass man an dem Virus stirbt. Dass die beiden und der andere Opa gut auf sich aufpassen. Aber dass sie irgendwann sterben werden, wenn ihr Leben zu Ende ist. So wie wir auch. Und dass niemand weiß, wann das sein wird. “Aber das will ich nicht!”, sagte sie trotzig und ein bisschen erschrocken. “Ich auch nicht”, hätte ich am liebsten gesagt.
Kinder haben einen anderen Begriff vom Tod als wir Erwachsenen.
Je jünger sie sind, desto weniger können sie wirklich verstehen, was es bedeutet. Was sie aber gut begreifen, sind unsere eigenen Berührungsängste mit dem Thema. Kinder haben feine Antennen, gerade für all das Ungesagte. Für das, was wir nicht an uns heranlassen möchten. Und Kinder bohren für ihr Leben gern in unseren schwarzen Löchern.
Wie aber kann das Ende seinen Schrecken verlieren? Für mich? Und damit auch für meine Kinder? Vielleicht nur, indem es einen Platz in unserem Leben bekommt. Als Erinnerungsanker, dass wir nicht ewig Zeit haben. Zu leben, zu lieben, zu lachen. Dass “irgendwann” vielleicht ein schlechter Zeitpunkt mag. Dass “jetzt” genau gut ist. Sich nicht vor den Gedanken unserer Endlichkeit zu ducken. Sondern eine Haltung zu entwickeln, die das Leben schätzt. Und zwar nicht nur in seinen Höhepunkten, sondern auch im ganz banalen Alltag. Gerade da. Nur so, denke ich, können wir am Ende auf ein erfülltes Leben zurückblicken.
Vor einigen Wochen las ich im Süddeutsche Zeitung Magazin ein Interview mit einem Trauerredner, der mehr als 2500 Beerdigungen begleitet hat. Was ein reiches Leben seiner Erfahrung nach ausmacht, wurde er gefragt. Die Antwort war schlicht: Liebe. Nicht Geld, nicht Erfolg. Nur, dass der Mensch Liebe gegeben und bekommen hat. Auf dem Sterbebett ist eben kein Platz für Eitelkeiten.
Ich erzähle den Kindern gern von Oma.
Allein mein Großer hat meine Mutter noch erlebt, die anderen beiden kennen sie nur aus Erzählungen. Sie war eine tolle Frau, liebevoll, stark, mutig – auch am Ende. Sie hätte gute Gründe gehabt, mit ihrem Leben zu hadern. Stattdessen hat sie es genossen, jeden Moment, so gut sie eben konnte. Weil sie früh begreifen musste, dass es irgendwann vorbei sein würde. Dass sie ein gutes Leben hatte, davon war sie überzeugt. Der Tod hat sie nicht geschreckt, obwohl sie gern noch länger gelebt hätte. Sie ist mein großes Vorbild.
Weil: Ich wäre noch nicht bereit, jetzt mit gutem Gefühl gehen zu können, für immer. Aus der Perspektive der Endlichkeit merke ich gerade wieder, wie häufig ich mich mit Nichtigkeiten befasse. Mich an Dingen abarbeite, die mehr als zweitrangig sind. “Sie hat immer dafür gesorgt, dass die Kinderzimmer aufgeräumt waren”, ist sicher nicht der Satz, der auf meiner Trauerfeier fallen sollte. Der Gedanke an den Tod kann also ganz inspirierend sein: Als Chance auf das Leben, das man wirklich führen möchte.

Mir hilft es gerade, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Dankbarkeit für das vermeintlich Selbstverständliche zu empfinden: Familie, Liebe, Gesundheit. Und den Kindern hilft, dass wir uns gemeinsam an die erinnern, die vor uns gegangen sind: An Oma. Unsere Katzen. Ich spreche mit ihnen darüber, dass man einen Platz im Leben behält, auch wenn man nicht mehr da ist. Denn wie oft fällt unvermittelt der Satz: “Sitzt Oma jetzt auf einer Wolke und guckt mir zu?” In der Gedankenwelt meiner Kinder ist sie ein fester Bestanteil unserer Familie.
Als ich vor ein paar Tagen mit einer Freundin über das Thema sprach, gab sie mir ein Buch mit: Ente, Tod und Tulpe. Es ist ein Bilderbuch für Kinder – und vielleicht noch ein klein wenig mehr für uns Eltern. Es geht um das Leben. Um den Tod, der ein Freund wird. Und der am Ende tut, was der Tod eben tun muss. Die Kinder mögen es. Und ich auch. Es ist auf gute Art ergreifend. Und tröstlich, weil es das Unvermeidliche beschreibt, ohne dass man sich davor fürchten müsste.
Aber selbst wenn der Tod hier gerade häufiger Thema ist: Morbide Stimmung kommt selten auf. Weil Kinder die personifizierte Lebendigkeit sind. Und dabei hundert Mal unbefangener als wir: “Papa und du, ihr sollt nie sterben”, meinte meine Tochter ein anderes Mal. “Aber dann gehört uns doch das Haus ganz allein”, wandte ihr großer Bruder ein. Ziemlich begeistert. Das Unvermeidbare hat eben auch seine guten Seiten.
Hand aufs Herz: Traut ihr euch an das Thema heran? Wie auch immer – lasst uns das Leben feiern!
Alles Liebe,








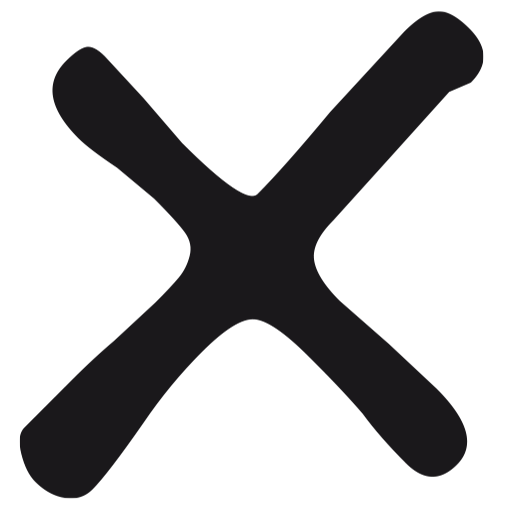
Tod und Sterben und ganz besonders auch das “Danach” sind hier schon lange vor Corona immer sehr spannend gewesen. Dieses Mysterium, was wohl niemals jemand lösen wird.
Als im Januar unser geliebter Hundeopa bei uns Zuhause starb und unser Großer es auch mitbekommen hat (der Kleine auch, aber der ist erst 1 Jahr alt), bekamen die ganzen Gedanken und Gespräche über den Tod noch eine ganz andere Qualität.
Er wollte nicht mit im gleichen Raum sein, aber alles genau wissen. (wir haben ihn zu nichts gezwungen und es einfach laufen lassen)…
Neben der unbändigen Trauer, der Wut, der Hilflosigkeit und Angst kam für unseren großen Sohn (5 Jahre) auch eine ganz andere Art des Verständnisses, was ihn richtig hat wachsen lassen. Er ist seitdem sehr viel klarer in der ganzen Thematik. Er hat erfahren und wirklich gespürt, dass tote Körper zwar mitunter aussehen als würden sie schlafen, aber eine ganz andere “Aura” von ihnen ausgeht, sie nicht mehr atmen, anders riechen etc.
Dass wir ihm währenddessen immer alles erklärt und beschrieben haben, so gut wir konnten und auch unsere eigene Trauer nicht zurückgehalten haben, hat ihm sehr geholfen, glaube ich.
Ich kann übrigens sehr das “flying wish paper” (gibts bei Amazon) empfehlen. Wir beschreiben es sonst immer an Silvester mit Wünschen für das neue Jahr, aber in dem Fall haben wir unserem Hundeopa liebe Gedanken und Wünsche mit auf den Weg gegeben- was unserem Großen auch sehr gefallen hat.
Seit dieser Erfahrung ist unser großer zumindest echt sehr viel stabiler mit Umgang. Er will natürlich immernoch nicht, dass wir sterben, hat aber keine Alpträume mehr davon, vermutlich weil er es einmal live erlebt hat und sein Kopfkino einfach Ruhe hat.
Liebe Grüße aus Bramfeld!
Hej liebe Rike, danke für deine berührende Geschichte. Ja, unser ältester Sohn hat vor ein paar Jahren auch unsere Katze mit begraben – aber einfach war es nicht. Dennoch war es wichtig, seitdem hat er einen anderen Begriff von dem Thema. Die Idee mit den flying wish papers finde ich wunderschön, das behalte ich im Kopf. Allles Liebe, Katia
Wir sprechen mit unserer Tochter sehr offen darüber. Sie stellte bereits Fragen dazu, seit sie 3 Jahre alt war.
Auch ein schönes Kinderbuch zu dem Thema: Die besten Beerdigungen der Welt von Und Nilsson.
Hej liebe Brigitte, davon las ich jetzt auch schon mehrfach – das klingt super!
Lieben Dank und schönes Wochenende 😊
Ich finde es ganz wichtig, mit Kindern darüber zu sprechen, aber das geht natürlich einfacher, wenn man selbst sich damit auseinandersetzt. Wir sind viel in der Natur unterwegs, gerade jetzt im Frühling ist ja auch viel los dort mit brütenden Vögeln etc. und es stirbt da immer irgendwas. Kleine Vögel werden von Katzen gefressen, fallen aus dem Nest, Falter werden gefangen…Das sind alles kleine Tode, die Kinder, wenn man sich drüber unterhält, miterleben und auch mitfühlen. Da rollen dann auch mal Tränen, aber das zeigt, wie der Tod zum Leben gehört. Bei einem selbst anzufangen ist schon schwerer. Ich habe Abschiedsbriefe geschrieben an die Familie, für den Fall, dass ich verunfalle. Das ist hart, aber es hilft sehr, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Der Tod ist in meinem Kopf immer präsent, morgen kann es vorbei sein. Es ist schwer, die Balance zu finden, nicht zu verzweifeln, weil es eben in einer Sekunde vorbei sein kann, und doch sein Leben freudig zu leben. Aber ich denk ich schätze vieles mehr und lasse einige Dinge einfach so sein, weil ich mich nicht über Nichtigkeiten aufregen mag. Und wenn man das schafft, bei den vielen Entscheidungen, die man täglich trifft, doch ab und zu die eigene Endlichkeit zu bedenken, fallen so manche Entscheidungen anders aus. Ich würde zB wenn morgen alles zu Ende wäre, keine Reise machen wollen, sondern einfach den Tag hier im Alltag zu Hause genießen, mit denen, die ich liebe. Für andere sieht das ganz anders aus, aber für mich ist es so. Ich finde die Auseinandersetzung mit dem Tod sehr wichtig für mich, sonst verfolgt mich der schwarze Gedanke wie ein Geist. Wenn ich mich ihm stelle und ihm seinen Platz im Leben einräume, ist er kontrollierbarer und weniger angsteinflößend für mich. Aber nicht jeder spürt die Endlichkeit auch so stark wie ich, manchmal beneide ich diese Leichtigkeit auch. Andererseits glaube ich dass ich auch relativ stark meine Entscheidungen nach meinen Vorstellungen eines erfüllten Lebens treffe und das ist ja auch was wert. Der Tod ist immer an unserer Seite…
Liebe Helga, vielen Dank für deine Gedanken zu dem Thema, das natürlich sehr aufwühlend sein kann. Ich finde die Idee mit den Abschiedsbriefen eine sehr schöne, wenn auch sicher schwer. Die Perspektive des Endes ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn es um die von dir thematisierten Nichtigkeiten geht. Das rüttelt so manches zurecht. Alles Liebe, Katia
Danke, dass du das Thema aufgreifst!
Ich arbeite mit Kindern im Kita-Alter und stelle immer wieder fest, dass sie viel weniger Berührungsängste bei dem Thema haben als wir Erwachsenen. Sie sind oft sehr kreativ, wenn es um Rituale und Andenken geht und haben einen so intuitiven Zugang zu einer spirituellen Sicht auf die Welt, dass es für sie tatsächlich ok zu sein scheint, dass auch die Erwachsenen nicht wirklich wissen, was da passiert, wenn jemand stirbt – und was danach kommt.
Wir Erwachsenen fühlen uns oft hilflos, empfinden Tod und Sterben als tabuisiert und haben keine richtige Sprache dafür – und kaum eigene Erfahrungen mit Sterbenden. Das führt oft dazu, dass das Thema gar nicht erst angepackt wird. Es hilft mir total, mich auf die Sichtweise der Kinder einzulassen und ihnen einfach einen Raum zu geben, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken, so vielfältig wie möglich, z. B. auch mit kreativen und non-verbalen Aktionen.
Hej liebe Sina, bei deinem Kommentar bin ich vor allem an der Formulierung “wir haben keine Sprache dafür” hängen geblieben. Denn genau so ist es. Ich finde es enorm schwer, die passenden Worte zu finden, auch wenn (oder gerade weil) ich selbst Erfahrungen mit Sterben und Tod gemacht habe. Insofern nehme ich gern den Umweg über die Bücher, die einem ein wenig auf die Sprünge helfen. 🙂 Alles Liebe, Katia
Es kommt etwas spät, aber Ich mag zu dem Thema das Buch „das platte Kaninchen“ von Oskarsson total gerne.
Ein Kaninchen liegt plattgefahren auf der Straße und Hund und Ratte finden, dass es da nicht liegen bleiben kann und lassen sich etwas gutes einfallen.
Kein typisches Buch zum Thema denke ich, aber eines, was dem Tod mit relativer Leichtigkeit und viel Kreativität und auch Humor begegnet.
Grüße Christina
Hej liebe Christina, das Buch klingt super! Ich mag die humorvolle Herangehensweise sehr. Mir wurde auch schon mehrfach “Die schönsten Beerdigungen der Welt” ans Herz gelegt. Das hört sich für mich auch nach einer guten Perspektive auf das Thema an. Liebe Grüße!
Mein Großer war mit mir bei einer Routineuntersuchung während der Schwangerschaft, bei der rauskam, dass das Baby keinen Herzschlag mehr hat. Damals war er 7 Jahre alt. Ich bin mit ihm wie benommen nach Hause gefahren und zu Hause dann in Tränen ausgebrochen.
Ich werde nie vergessen, wie er zu mir kam, mich ganz liebevoll anschaute und dann sagte: “Der liebe Gott hat uns ein Geschenk geschickt und jetzt ist es unterwegs kaputt gegangen.”
Liebe Anney, das ist absolut herzzerreißend. Und tut mir unendlich Leid. Dennoch ist es ein wenig tröstlich, wie unvoreingenommen Kinder damit umgehen können. Alles Liebe für dich und deine Familie, Katia