Im Café, der Dreijährige daddelt vertieft auf dem Smartphone. Die Mutter sitzt daneben und hat keinen Blick für den Jungen – ihre Augen sind genüsslich geschlossen. Neben ihr dampft ein Becher mit Kaffee. Die Mama bin ich ich. Die Sonne scheint – doch die Kinder umringen drinnen ein Tablet, aus dem es vernehmlich pingt und plärrt. Die Mutter macht im Garten Yoga. Die Mama bin ich. Das Kind bringt nur einen schon angebrochenen Kuchen als Geburtstags-Goodie mit. Die Mutter hat versäumt, einen eigenen Kita-Kuchen zu backen. Die Mama bin ich…
Seitdem ich Mutter bin, tue ich dauernd Dinge, die ich früher im Brustton der Entrüstung verurteilt hätte: Die Kinder wochentags vor Paw Patrol parken, um einen Moment ohne Geschrei und Lärm zu erkaufen. Die zweite Runde Eis zu spendieren, um einem Drama shakespeareschen Ausmaßes an der Supermarktkasse vorzubeugen. Drei von sieben Tagen Nudeln mit Butter und Parmesan zu servieren, um Diskussionen zu vermeiden und Nahrungsaufnahme zu gewährleisten.
Das hat nichts mit Nachlässigkeit zu tun, sondern mit Selbsterhaltungstrieb.
Denn wenn ich eines in den vergangenen neun Jahren gelernt habe: Geht es mir nicht gut, hat niemand was davon. Sorge ich nicht auch für mein Wohlbefinden – und zwar nicht reflexhaft erst an allerletzter Stelle – gerät das Familiengefüge schnell in Schieflage. Und für mein Wohl ist es immens wichtig, dass ich inmitten meines Lebens mit drei wunderbaren, lebhaften, streitbaren Kindern Inseln der Ruhe, des Friedens und des Nichtkümmerns schaffe. Mit allen legitimen Mitteln. Und gerade Medienzeit rettet mir dabei oft – pardon – den Arsch.
Natürlich geht es auch anders. Wenn ich genügend Zeit und Reserven habe, lese ich gern ausdauernd vor, krame aus der Küchenbank mit den Gesellschaftspielen Skip-Bo oder Tridom raus, gehe mit meinem Trio auf den Spielplatz. Die Betonung liegt allerdings auf dem Wörtchen “wenn”. Wenn ich Kraft und Kapazitäten habe, bleiben Endgeräte aus. Führe ich mit Freuden pädagogisch wertvolle Diskussionen über Sinn und Unsinn von Zucker-Überdosen. Nehme ich die Kinder mit auf die Yogamatte und leite Hund, Katze, Kuh auf Kinderniveau an. Wenn.
Seit einem Jahr sind die Krafttreserven aber oft so leer wie der Akku unseres Tablets.
Und wenn ich schon Tage über meine persönlichen Grenzen hinaus bin, muss ich zwischendurch in den Standby-Modus wechseln. Muss in meinem Kopf weißes Rauschen herrschen dürfen. Müssen meine Augen eine Pause einlegen vom dauernden Security-Check wer-fällt-gleich-in-den-Graben.
Dann entlastet es mich enorm, für eine Stunde ein Hörspiel anzuschmeißen – auch bei bestem Draußenspielwetter. Dann entspannt es mich, auf meine Apps zu starren statt meine Kinder zu betrachten. Dann tue ich mir selbst einen Gefallen und dös auf der Sonnenliege ein, statt das Abendbrot vorzubereiten. All das ist verständlich. All das ist erlaubt. All das ist muttermenschlich.
Ich muss das hier so plakativ aufschreiben, weil: Mein größter Kritiker bin immer noch und immer wieder ich selbst. Doch wenn ich mir aus falschem Stolz, aus Scham, aus gesellschaftlichem Druck heraus diese wichtigen Auszeiten zum Abschalten versage, dann knallt’s irgendwann gewaltig. Bei mir – und bei uns allen.
Meine Kinder haben mehr von einer Mutter, die sich zwischendurch rauszieht, als von einer, die sie aus Erschöpfung irgendwann anbrüllt.
Die auch bei sich mal fünf gerade sein lässt statt permanent zu performen. Die sich und ihren Kindern erklärt, dass sie nicht unendlich belastbar ist. Dass Pausen genauso wichtig sind wie Aktion. Daher ist dieser Text auch ein Plädoyer für mehr Gelassenheit – mit sich selbst und mit anderen. Denn wie schnell sind wir dabei, die Augen auch über fremde Mütter zu rollen.
Die ihrem Nachwuchs offenbar zu viel durchgehen lassen. Die sich ihrer Fürsorge durch Games entziehen. Die lautstarkem Gezeter mit XL-Pommes die Mäuler stopfen. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns läuft mehr auf 100 Prozent. Wir alle brauchen zwischendurch eine Stop-Taste – ganz gleich wie. Und noch viel mehr brauchen wir das Gefühl von Solidarität und Empathie. Von innen und von außen.
Meine Kinder werden nicht zu unglücklichen, verzogenen, antriebslosen Menschen, nur weil ich als ihre Mutter zwischendurch an mich denke. Im Gegenteil. Wenn ich meine Kraftereserven wieder auffülle, habe ich später so viel mehr zu geben: Liebe, Aufmerksamkeit, Energie. Und das ist es, was eine Kindheit zu einer glücklichen macht – und das Mutterdasein wirklich erfüllend. Sich nicht immer nur um die anderen zu kümmern. Sondern auch um sich. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Darüber muss niemand urteilen, am allerwenigsten wir selbst.
Seid ihr gut genug zu euch?
PS: Ich bin gerade über das Buch Radikale Selbstfürsorge. Jetzt! von Svenja Gräfen gestolpert. Ich glaube, ich werde es mir im Urlaub mal vornehmen. Vielleicht ja auch eine Idee für euch?
Alles Liebe,










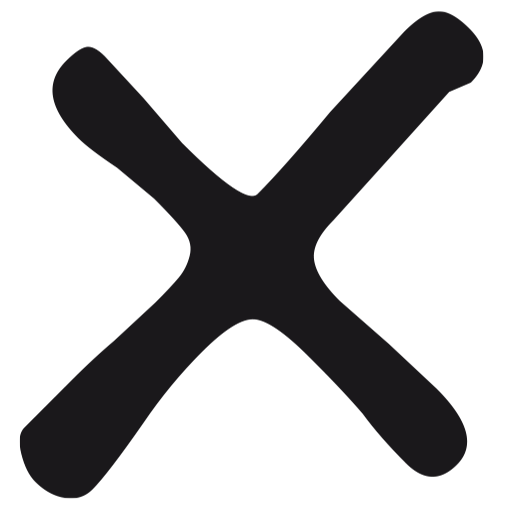
Liebe Katia,
vielen Dank für den ehrlichen Text, mir geht so oft genauso, immer mit schlechtem Gewissen.
Aber es ist gut zu wissen, dass ich nicht alleine bin :-).
Liebe Grüße, Daniela
Hej liebe Daniela, vermutlich kennen das die meisten Mütter, wenn sie ehrlich sind 🙈 Es ist gut, sich das immer wieder bewusst zu machen, um sich nicht dauernd selbst dafür zu verurteilen… Alles Liebe!
Liebe Katia, so wahr! Und wie lange hat es bei mir gedauert, bis ich das verstanden habe! Es hat sich am Anfang so schlecht angefühlt. Gut Ding will Weile haben…
Liebste Grüße Annette
Hej Annette, aber um so besser, dass du es jetzt verinnerlicht hast! 🧡 Man muss sich was gönnen können – gerade als Mutter… Alles Liebe!
“mir geht es oft genauso”…………..–> Entschuldige den Schreibfehler, das Bügeleisen wartet bereits :-))
Vielen Dank für diesen ehrlichen und so wichtigen Text!
Jede Mama muss sich einfach mehr Auszeiten nehmen!
Hej liebe Christina, ja, das ist immens wichtig 🧡. Alles Liebe
Hallo Katja,
Vielen Dank für den tollen Text!
Wie recht du hast…. Zufriedenr Mutter- zufriedene Kinder !
Habe drotzdem noch eine Frage ; dürfen die Kinder bei euch, denn immernoch nicht zur Schule ?
Bei uns ( Schweiz ) dürfen sie nämlich schon lange wieder gehen und auch alle Freizeitangebote sind mit entsprechenden Vorsichtsmassnahen und Schutzkonzepten wieder offen.
Grüsse aus der Schweiz
Christina
Hej liebe Christina, danke für dein liebes Feedback! 😊 Um auf deine Frage zu antworten: Doch, die Schulen sind/waren wieder offen – jetzt hat Hamburg allerdings schon wieder Ferien. Freizeitangebote sind wieder (vorsichtig) gestartet – aber dennoch habe ich ab13 Uhr immer alle3 Kids zuhause (jetzt 24/7) – und da kann der Tag schon mal lang werden…🙈 Alles Liebe in die Schweiz!
Hallo Katia,
Vielen Dank für deine Antwort,
Es ist immer interessant wie es in anderen Familien und in anderen Ländern so läuft….
Alles Liebe
Christina
Daaaaaaaaannnnkkkkkeeeeeeee🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Wie gut dein Text tut!!!
Wie schön 🧡
Ich war mal gut in Pausen und Gelassenheit, und sich das schlechte Gewissen Wasser wie weg – in den letzten Monaten ist mir die Ruhe abhanden gekommen. Ich habe sie noch nicht wiedergefunden, habe das Gefühl, diese kleinen Ruheoasen im Alltag reichen gerade nicht, dabei möchte ich diese Reizbarkeit gar nicht haben… ein Start war der letzte Montag – Mann und alle Kinder aus dem Haus,.. ich habe ohne schlechtes Gewissen minus gemacht und mich nur um mich gekümmert. Tat mal wieder gut!
Lieber Gruß und schone Ferien, wir haben noch vier Wochen vor uns.
Verflixt, zu schnell abgeschickt, Worterkennung. Gleich zu Beginn sollte es heißen, und auch das schlechte Gewissen war weit weg.
Hej liebe Annie, wir fahren nach diesem Ausnahme-Jahr vermutlich alle ziemlich auf Reserve, daher reicht der kurze Kaffee in der Sonne oft nicht mehr aus, die Akkus wieder zu laden. Daher ist es genau gut, dass wir uns in der Familie (gegenseitig) diese Freiräume verschaffen, uns ein paar Stunden am Stück (oder ein ganzes Wochenende…?) nur um uns kümmern zu dürfen. Alles Liebe, genießt die Ferien dennoch.