Bis vor kurzem habe ich digital, wenn auch nicht in der Steinzeit, so zumindest noch im Mittelalter gelebt: Meine Social-Media-Aktivitäten ließen sich gut an meinem Facebook-Account ablesen (konsequent null Aktivität), von Blogs hatte ich gehört, aber keinen konsumiert und Instagram war mir ein Mysterium – irgendwas mit vielen Fake-Fotos und vernachlässigbarem Content. Ich war absolut zufrieden damit, hoffnungslos analog und oldschool zu sein. Sogar ein wenig stolz, meine Zeit ausschließlich im echten Leben zu verbringen. Digitalpioniere durften gern die anderen sein. Und dann kam dieser Job hier…

“Du solltest dir dann auch unbedingt einen eigenen Insta-Account anlegen”, meinte Claudi damals zu mir. “Äh, na gut. Und wie funktioniert, wie bespielt man das …? Und meinst du, das ist wirklich nötig?” Ok, diese Frage stelle ich mir heute noch. Häufig im Zusammenhang mit der Überlegung, ob meine Insta-Nutzung noch normal oder schon neurotisch ist.
Innerhalb eines Jahres bin ich von der analogen Fachfrau zum Social-Media-Junkie mutiert.
Mein Verhältnis zum digitalen Konsum ist dabei ähnlich wie das zu Schokolade: Ich würde beides gern beschränken, weil es bestimmt besser für mich wäre – aber mein Schweinehund ist stärker als Superman. Und so habe ich morgens als erstes und abends als letztes mein Smartphone in der Hand: Freue mich über neue Likes, ärgere mich über manchen Kommentar und scrolle durch meinen Feed, während ich von Foodporn zu Feminismus, von Elternschaft zu Ehrenamt springe. Und am Ende ein Gefühl wie nach einer Tüte Linsenchips habe: Fürs gute Gewissen war auch was dabei, aber in Summe doch ohne nennenswerten Nährwert…
Mittlerweile verbindet Insta und mich eine leidenschaftliche Hassliebe: Ich habe einen wahnsinnig spannenden Kosmos entdeckt, in dem es alles zur gleichen Zeit gibt – Weltbewegendes und Triviales, Gutes und Schlechtes, eine Welt, in der jede noch so kleine Randgruppe eine Stimme hat. Und ich bin ein Teil davon. Ich bin auch ein unbestreitbarer Fan des Community-Gedankens, ich mag den Austausch, die Inspiration und – wenn er konstruktiv klappt – den Diskurs mit anderen.
Gleichzeitig laugt mich die Fülle, das Tempo und immer öfter auch der Ton der User untereinander aus. Und zwar nicht nur psychisch, sondern auch physisch: Eine Überdosis Insta macht sich mit Kopfschmerzen, einem Gefühl von Abgeschlagenheit und Magenflattern bemerkbar. Ein ausgewachsener Kanal-Kater. Und jedes Mal gelobe ich mir selbst gegenüber Besserung. Mit meist mäßigem Erfolg: Ich bin einfach dem schnöden Suchtfaktor erlegen.
Früher war ich dankbar darum, im Netz nicht sichtbar zu sein.
Wer und wo ich war, was ich mag, mit wem ich unterwegs bin, ging nur mich und mein analoges Umfeld etwas an. Jetzt gebe ich freiwillig viel von mir preis – und das erstaunlich gern. Als ausgebildete Redakteurin ist mir das mich-anderen-zeigen natürlich nicht gänzlich unvertraut: Für Reportagen habe ich in Magazinen früher auch Ausschnitte von mir und meinem Leben geteilt, aber längst nicht so frequent und so persönlich wie hier. Nicht in dieser Unmittelbarkeit, die Social Media bietet.
Das liegt natürlich in der Natur der Sache: Als Bloggerin, die sich dem Thema Familie und Frausein verschrieben hat, fühlt sich das Texten immer ein wenig nach Tagebuch an. Denn ich schreibe mit der größtmöglichen Ehrlichkeit und Nähe mein Leben auf – und verzichte dabei bewusst auf Weichzeichner, inhaltlich und optisch. Ich bin gern authentisch. Persönlich, aber nicht zu privat. Ich glaube, das macht mich hier aus. Und gleichzeitig macht mich das angreifbar: Wenn sich jemand über meinen Erziehungsstil oder meine Ansichten mokiert, trifft er eben auch mich. Noch fehlt mir mitunter das dicke Fell, um das mit einem Schulterzucken zu parieren. Höhen und Tiefen liegen hier einfach verdammt dicht beieinander.
Zwischendurch geht mir die digitale Selbstinszenierung auch gehörig auf den Nerv.
Vor allem, wenn ich ein paar Tage abstinent war. Es fühlt sich wie eine Freiheit an, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie vermisse: Die Freiheit, nicht dauernd gesehen, bewertet, verglichen zu werden. Die Freiheit, nicht dauernd performen zu müssen.
Dann richte ich mich für eine Weile wieder sehr behaglich in meiner analogen Welt ein und sehe mit Abstand betrachtet, was Insta und Co vor allem sind: Filterblasen, die nur bedingt etwas mit der Komplexität des echten Lebens zu tun haben. Und dennoch unbestreitbar anziehend sind. Jobbedingt kehre ich nach ein paar Tagen immer wieder zurück – und der Social-Media-Zirkus beginnt von neuem. Ich weiß schon genau, warum ich die Finger von TikTok und weiteren Selbstdarstellungs-Portalen lasse:
Social Media ist ein Zeitfresser. Ein Manipulator, der meine Wahrnehmung der Welt unmerklich verschiebt, und zwar meist an der Oberfläche, selten in die Tiefe.
Und plötzlich hadere ich beim Blick auf meinen Foto-Account mit den vielen feinen Fältchen um meine Augen, weil sie inmitten der polierten Social-Media-Welt wie ein Fossil wirken. Dann fühl ich mich wie ein schwerfälliger Dino neben lauter niedlichen Rehkitzen. Und auch, wenn ich mich für einen emotional recht stabilen Menschen halte: An manchen Tagen muss ich dreimal tief einatmen, bevor ich ein filterfreies Bild von mir poste. Weil ich eben aussehe, wie eine 44-jährige Frau aussieht, die drei lebhafte Kinder und schon ziemlich viel erlebt hat. Insta, du blödes Biest!
Wenn ich die Beziehung zu meinem digitalen Ich retten will, muss langfristig etwas geschehen. Und wo ich eh gerade in der Steinzeit-Rhetorik unterwegs bin, fällt mir ein Spruch meiner Oma ein: “Willst du gelten, mach dich selten.” Das sehen die Social-Media-Algorithmen natürlich anders, aber für mich persönlich ist eine gewisse Distanz einfach gesünder.
So verordne ich mir gerade feste (Arbeits-)Zeiten auf Insta, damit ich nicht alle zehn Minuten die neuesten Entwicklungen checke. Versuche es, wie das Jobtool zu behandeln – was es letztlich für mich auch ist. Will regelmäßig komplette Wochenenden offline gehen, mir Urlaubsphasen zugestehen. Und oute mich selbst mit diesen Überlegungen vermutlich als komplett oldfashioned, denn: Digital Detox machen die nativen Netz-Nutzer schon seit Jahren …
Pflegt Ihr auch eine so komplizierte Beziehung zu Eurem digitalen Ich?
Alles Liebe,








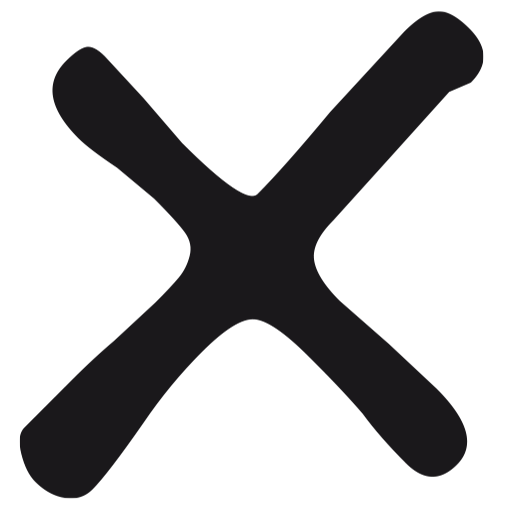
Juhuuu, was für ein spannendes Thema und wie cool dass du auch so ein Dinosaurier bist wie ich.
Ich finde es sehr witzig wie du deinen bisherigen Social Media Lebenslauf beschrieben hast. Stell dir vor ich bin nicht mal bei Facebook. Letztlich ist mein Grund reiner Selbstschutz. Ich will einfach im wahren, nackten und unbeschönigten Real-Life leben und mein einfaches Leben zelebrieren. Ich hab mich ein paar mal bei Instagram angemeldet und nach ein paar Tagen wieder angemeldet. Für mich steckt da leider zu viel Selbstinszenierung dahinter und auch wenn ich schmachtend alle Fotos inhaliert habe und in meinem Kopf eins nach dem anderen abfotografierte wurde mir schnell bewusst dass die dringende Gefahr besteht, ungesundes Suchtpotenzial zu entwickeln.
Zudem hab ich einfach schiss was es mir mir macht. Was ich nicht weiß..,?
Ach je
Mal sehen was noch kommt. Aber im Moment bin ich sehr glücklich frei zu sein von allen insta-Zwängen und dankbar für mein einfaches schönes Leben.
Aber ich hab mich total gefreut von deiner Erfahrung zu lesen! Hätt ich nicht gedacht, tatsächlich! Ich freu mich total dass du in Claudis Team bist und freu mich über jeden ehrlichen Beitrag von dir!
Hej liebe Hannah, ja, wir Dinos. 😉 Ich zähle mich irgendwie immer noch dazu, auch wenn ich jetzt viel mehr mit Social Media zu schaffen habe als noch vor diesem Job, den ich sehr liebe. Vor allem deshalb, weil es total inspirierend ist, mit Euch hier auf dem Blog oder eben auch auf Insta im Austausch zu sein. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass ich mich als reine Privatperson in den Social-Media-Kosmos begeben hätte – ich bin auch eher der Suchttyp 😉
Und ich freu mich gerade riesig über dein Kompliment, weil es die schönste Bestätigung meiner Arbeit ist, wenn ich weiß, dass Euch meine Texte gefallen. 🙂 Alles Liebe, auf bald, Katia
Hallo Katja,
Ich bin bei instagram nur Konsumentin. Ich kann nicht gut schreiben und hab auch keine Zeit und Lust mein Leben irgendwie in Szene zu setzen und zu zeigen. Meine drei kleinen Mädels halten mich gut auf Trab. Aber ich lese sooooo gerne deine Texte! Ich empfinde so Vieles ganz genauso. Ach und dein Schreibstil ist auch einfach so unterhaltsam – leicht wegzulesen und dabei so überlegt und intelligent! Deshalb wollte ich auch fragen, ob dein insta Account privat ist oder wie man dich dort finden kann. Ich würde gerne noch mehr von dir lesen.
Viele Grüße
Claudia
Hej liebe Claudia, o wie schön, danke für dein tolles Kompliment 🙂 Das ist ein fantastischer Start in diesen Sonntag. Bei Wasfürmich veröffentliche ich jede Woche zwei Texte – da kannst du mich verlässlich lesen. Darüber hinaus poste ich gerade nichts weiter – wenn du regelmäßig bei WFM vorbeiliest, bist du absolut auf Stand. Freu mich, wenn du weiterhin mitliest 🙂 Alles Liebe, Katia
Hallo Katja,
ich bin in der zweiten Corona – Welle durch Zufall auf “Was für mich” gestoßen und habe es abboniert, weil mir Euete Texte total gefallen. Ich habe nicht immer Zeit zu lesen, finde Euere Beiträge aber seht inspirierend und kann mich oft damit identifizieren. Und ja, ich bin auch so ein Dino… (mittlerweile 51) und meine zwei Jungs (12 und 16) machen mir das oft sehr deutlich. Für die beiden ist die digitale Welt total normal. Wobei bei den beiden Facebook und Ista als old-fashioned gilt. Mein großer nennt mich immer Boomer deswegen. Zurück zu Deinem Verhalten in Bezug auf die sozialen Medien: Ja, sie können total süchtig machen. Ich erlebe das auch immer wieder und muss mir dann eine Zwangspause auferlegen. Ich bin mittlerweile sogar froh, wenn das Internet mal wieder abstürzt…
Ich finde es total richtig, dass du deine Medienpräsenz und damit deine Zeit im Netz als Job ansiehst. Und feste Zeiten sind dafür sicherlich förderlich. Und jeder braucht auch mal eine Auszeit von Social Media. Zu viel davon macht krank. Habe gerade gestern wieder einen Artikel darüber gelesen. Da würde der Vergleich gebracht “wie bei Momo und den grauen Männern, die die Zeit stehlen”. Die sozialen Medien können ziemliche Zeitfresser sein. Daher nimm Dir die Auszeit davon für Dich (und deine Familie) und genieße diese Zeit. Ich wünsche Dir ein schönes Social Media freies Pfingstwochenende! (und fände es TOTAL OK, wenn Du hierauf erst zu deinen “festgesetzten Arbeitszeiten” antwortest!)
Hej liebe Angelika, back to work – und da flattert mir deine nette Nachricht ins Postfach… So fängt diese kurze Woche gut an. 🙂 Ich freu mich sehr, dass du auf uns gestoßen bist und hier gern mitliest. Zu der Social-Media-Chose:Ich finde es einerseits total spannend, wie nativ und intuitiv unsere Kinder mit der digitalen Medien umgehen – all das mussten und müssen wir uns mühsam erarbeiten (allein die dauernden neuen Features, die Instagram so bietet… 😉 Andererseits ist es eine Welt, in der viel Schein ist, wenig Sein, von daher möchte ich meinem Trio auch ein halbwegs passables Vorbild sein, was die Nutzung und die Zeit innerhalb dieses digitalen Kosmos anbelangt. Wenn ich mich versuche zu beschränken, tue ich es letztlich auch für sie. Freu mich, hier wieder von dir zu lesen, alles Liebe, Katia