Kürzlich stolperte ich bei der ehemaligen “Wir sind Helden”-Frontfrau Judith Holofernes über diesen Begriff: Pathologische Tapferkeit. Und fühlte mich sofort verstanden. Er beschreibt ziemlich genau, was dieser emotionale Cocktail aus Pflichtgefühl, Erwartungserfüllung, Höflichkeit und Hingabe gegenüber einer Million zu erledigender Dinge ist, die die Grenzen von Eltern und insbesondere von Müttern viel zu oft strapazieren…

Die, komme-was-wolle, die Fahne hochhalten, “Ach, es geht schon…” durch die zusammengebissenen Zähne murmeln, während sie am Rande der Erschöpfung durch die angebliche Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben navigieren, das irgendwie immer kurz davor scheint, zu implodieren.
Mütter am Rande des Nervenzusammenbruchs.
Die doch immer weitermachen, tapfer, tatkräftig, todmüde, weil es nicht anders geht, weil der gesellschaftliche Konsens ist, nicht zu jammern, sondern gefälligst zu machen, da zu sein und dabei gern noch den Anschein zu erwecken, es sei doch alles ein Klacks, allerhöchstens eine Phase und unsere Großmütter hätten noch so viel mehr gerockt, jetzt stell dich mal nicht so an. Und wenn das alles wirklich so furchtbar ist, dann hättest du eben keine Kinder bekommen sollen oder zumindest nicht gleich so viele.
Auf den Job bezogen heißt dieses Phänomen “Burn-on”, eine Art chronische Erschöpfung, die auch im Zusammenhang mit Anforderungen, für die man eigentlich brennt, auftritt. Der Psychiater Bert te Wildt erklärte dazu kürzlich im Interview mit GEO:
“Mit dem Begriff “Burn-on” versuchen mein Kollege Timo Schiele und ich eine Variante des Ausgebranntseins zu beschreiben, die nicht so fulminant durch einen Zusammenbruch auffällt, sondern bei der die Erschöpfung chronisch verläuft und Betroffene gerade noch in vielen Bereichen “funktionieren”. Sie bewegen sich dauerhaft an der Scheidelinie von Durchhalten und Zusammenbruch und verharren auf einer Art Vorstufe zum Burn-out.”
Ich finde, das illustriert ebenfalls sehr präzise unser Elterndasein: Wir lieben, was wir tun, wir lieben unsere Kinder, unser Familienleben, unseren Job – und doch sind wir oft latent damit überfordert, all diese Herzensdinge unter einen Hut zu bekommen.
Denn wie häufig kann man über sich hinauswachsen, wie oft das Unmögliche möglich machen, pathologisch tapfer sein, obwohl man sich viel lieber verkriechen würde, um mindestens drei Monate zu schlafen und keine Wäsche-Hausaufgaben-To-Do-Listen-Arzttermine-Einkaufen-Infekttage zu bewältigen? Erstaunlicherweise ziemlich häufig. Aber eben nicht immer.
Kürzlich kam so viel zusammen, es war dieser letzte Tropfen, der eher einem Wasserfall glich, dass es mir den Boden unter den Füßen wegzog. Und ich von einem Tag auf den anderen plötzlich keine Kraft mehr hatte, nicht mehr tapfer sein wollte oder überhaupt konnte. Ich war wie angeschossen. Allein der Gedanke an die alltäglichen Tätigkeiten überforderten mich komplett. Ich wollte am liebsten weit weg sein, allein, meine Ruhe, ich wollte keine feuchten Küsse, keine Fragen, keine Aufgaben, keinen Trost.
Ich wollte verschnaufen von diesem Hamsterrad, das niemals endet, zumindest nicht, solange die Kinder klein und bedürftig und zuhause sind – und plötzlich noch andere meinen Beistand brauchen.
Ich wollte nicht mehr die Bedürfnise anderer erfüllen in einem nie versiegenden Strom aus Anforderungen, Erwartungen, Pflichtgefühl, die mich auslaugen, auch wenn Liebe der Motor ist. Judith Holofernes hat mit dem Problem der pathologischen Tapferkeit damals ihren Rücktritt von dem Popstar, der sie lange war, verkündet. Sie wollte jemand anderes sein unter gleichem Namen (hier geht’s zu ihrem Post).
Ich kann meinen Job nicht kündigen, nicht den als Mutter, nicht den als Partnerin, Tochter, Schwester, Freundin und auch nicht das Schreiben – dafür sind all das viel zu große Herzensdinge. Ein Rücktritt davon käme einer Amputation gleich. Aber vielleicht braucht es neue Grenzen, für mich und für die anderem, braucht es noch mehr Inseln im Alltag zum Verschnaufen, braucht es weniger Kümmern und Kontrolle und noch viel mehr geschehen lassen ohne mein Zutun.
Es braucht weniger To-dos und mehr Laisser-faire – in all meinen Berufungen. Damit ich weiter brennen kann, aber auf kleiner Flamme – und nicht irgendwann verlösche.
Ich benötigte ein Wochenende, um mich wieder zu berappeln. Um das Gefühl zu haben, nicht nur allen Anforderungen, sondern vor allem mir selbst wieder besser gerecht werden zu können. Ich weiß doch eigentlich, wie das geht: Neinsagen. Stopsagen. Innehalten, mich fragen: Kann ich das gerade leisten? Will ich das? Kann das nicht auch jemand anderes übernehmen? Und spätestens, wenn ich merke, dass ich wieder mal mit zusammengebissenen Zähnen “Ach, es geht schon…” murmle, die Notbremse ziehen. Pathologisch tapfer mag ich nicht mehr sein.
Kennt ihr dieses Gefühl auch?
PS: Judith Holofernes hat jüngst ein Buch darüber geschrieben – über die Krisen, über Träume – ihre eigenen und die von anderen – und über wichtige Entscheidungen: “Die Träume anderer Leute” klingt genau nach der Lektüre, die ich gerade gut gebrauchen kann.
Alles Liebe, passt gut auf euch auf,








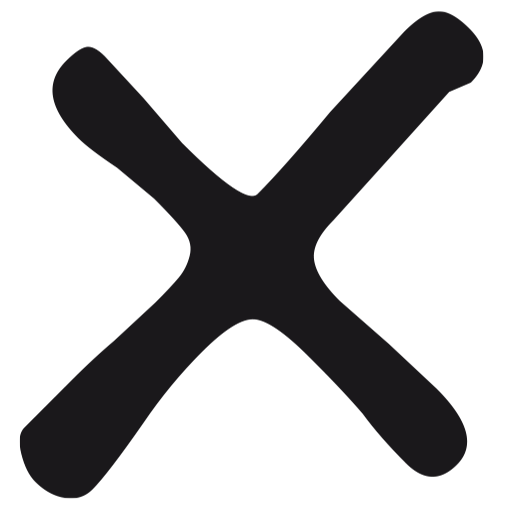
Hallo Katia, klasse geschrieben.ich wundere mich oft, was die jungen Mütter alles so können. Ich hatte früher Job und 1 Kind und keine Zeit für andere Dinge. Der Preis für die andren Dinge ist leider zu groß. Die anderen Dinge mache ich jetzt als Oma. Geht auch. Liebe Grüße von Elke
Hej liebe Elke, danke dir für dein liebes Feedback! 🙂 Ja, es ist viel – und wird gefühlt immer mehr. Vielleicht sind wir als Eltern auch einfach immer noch erschöpft von allem, was in den letzten jahren so los war – die Energiereserven schrumpfen auch bei uns rapide zusammen… Danke für deine Anteilnahme, genieß dein Oma-Dasein, das klingt wundervoll! Alles Liebe, Katia
Hallo Katia,
als ich meinen Beitrag abgeschickt hatte , war ich kurz erschrocken , weil er so hart klingt. Egentlich bin voller Bewunderung und vielleicht auch wenig neidisch auf die jungen Mütter und bin stolz, wie sie es anders machen als meine Generation. Mir fehlen gefühlt 20 Jahre und die hole ich jetzt erbarmungslos nach. Na ich versuche es wenigstens. Lach. Liebe Grüße von Elke
Hej liebe Elke, das habe ich gar nicht so empfunden, im Gegenteil. 🙂 Jeder rockt das auf seine Weise – ist doch schön, dass du jetzt Dinge nachholst, die früher nicht in dein Leben gepasst haben. Alles Liebe, Katia
Hallo Katja, oh ja, natürlich kenne auch ich das Gefühl. Mein Mann übrigens auch. Am Ende hat der Tag immer zu wenig Stunden und das Wochenende zu wenige Tage. Ich glaube aber schon, dass es anders ginge. Denn ich glaube wirklich, dass die Generation meiner Eltern und Großeltern es schwerer hatten. Deren Tag war übervoll mit Erledigungen und Arbeiten, heute ist er nur mit anderen Dingen ausgefüllt, denke ich. Und von denen könnten mein Mann und ich einiges auslagern. Aber wann denke ich daran? Wenn ich totmüde auf der Couch hänge. Zumindest kaufe ich mittlerweile konsequent Kuchen und Kekse für sämtliche Kinder- und Schulfeiern. Und ich stehe auch offen dazu. Vielleicht hilft es anderen Eltern, sich in dieser Hinsicht auch zu entspannen. Denn eigentlich müssten wir es uns nicht so schwer machen. Eigentlich…
Liebe Grüße Juliane
Hej liebe Juliane, ich weiß, was du meinst: Wenn ich derzeit meinen Mann anschaue, denke ich immer: “Du siehst aus, wie ich mich fühle…” Diese Kuchen-Mutter bin ich auch mittlerweile – und es hilft zumindest ein wenig. 😉 Noch viel mehr helfen tut es bestimmt, wenn wir aufhören würden, uns von vermeintlich besser organisierten, strukturierten, energetisierten Menschen blenden zu lassen, dass es doch möglich sei, all das auch noch mit einem Lächeln und perfekt gestylt hinzukriegen. Wir sollten uns lieber viel häufiger fragen: Was kann, was WILL ich wirklich leisten, wo kann ich Abstriche machen, wo nicht. Und es braucht Auszeiten, das spüre ich gerade wieder so sehr. Einen Abend ausgehen, eine Yoga-Runde am morgen, irgendwas. Hauptsache raus aus dem Hamsterrad. Alles Liebe, passt auf euch auf, Katia
Hallo Katja,
genau so ging es mir schon öfters… Du sprichst mir aus der Seele… ich mach auch immer und immer weiter weil es halt so sein muss … manchmal ist man einfach am Ende seiner Kräfte.
Vielen Dank für diesen tollen ehrlichen Beitrag! Liebe Grüße Manuela
Hej liebe Manuela, das freut mich – auch wenn der Anlass natürlich eher unerfreulich ist. ERschöpfung ist kein Einzelschicksal derzeit, wie man gut in all euren Kommentaren nachlesen kann. Ich versuche es mit kleinen Auszeiten für mich zu verbessern, Yoga, eine Runde laufen, ein Date mit einer guten Freundin. Da tanke ich dann immer wieder ein wenig auf. Alles Liebe, Katia
Ich kann alles nachvollziehen und auch nachempfinden, habe auch 2 Söhne und ein Pflegekind großgezogen. Es war immer eine Gratwanderung.
Alle Kinder sind erwachsen und stehen auf eigenen Beinen. Was nicht wirklich nervt, dass mir immer wieder abgesprochen wird, dass ich mittlerweile auch erschöpft und noch von Tag zu Tag kämpfe. Ich arbeite im Monat an die 240 Stunden (meist 24 Stunden Dienste), aber wenn ich klage, dass es mir zu viel wird (denn auch ein Haushalt ohne Kinder muss bewältigt, das Auto repariert, der Garten in Schuss gehalten, der Papierkram erledigt werden), bekomme ich die Antwort:” du hast doch keine Kinder mehr Zuhause, worüber jammerst du?”.
Ja ..ich habe 20 Jahre den Zirkus mit Kindern mitgemacht und jetzt arbeite ich viel zu viel, weil in der Pflege kaum noch Personal zu bekommen ist).
Ich fühle mich komplett übersehen und nicht verstanden. Oft kommt dann auch der ungebetene Rat, dass man einen Gang zurück schalten soll. Ich weiß aber wirklich nicht, wo ich zurückschalten kann . Den Arbeitgeber habe ich gewechselt und es ist der gleiche Mist (dafür besser bezahlt 😂)
Hach, es liest sich jetzt so mäkelig, aber es sind nicht nur die Mütter mit Kindern zuhause erschöpft. Es ist, glaube ich, gerade für fast alle eine Krisenzeit. Bitte nicht falsch verstehen
Hej liebe Petra, ja, wir sind alle bodenlos erschöpft, als Gesellschaft. Den Eindruck habe ich auch. Und es ist nicht mäkelig, wenn man das formuliert, weil man dieses Gefühl ja nicht herbeifantasiert, es ist ja real (und bei deinem Pensum absolut nachvollziehbar!). Ich versuche mir irgendwo Inseln zu schaffen, kleine Freiräume, in denen ich durchschnaufen kann, meist beim Sport. Den Kopf draußen lüften tut auch immer gut, zehn Minuten ohne To-Dos. Aber selbst dafür muss man sich disziplinieren. Ich wünsche dir alles Liebe und die Kraft, die es braucht, um all das zu bewältigen, Katia
[…] von wasfuermich beschreibt es in ihrem heutigen Post auch sehr treffend – wir Eltern sind pathologisch tapfer. Selbst wenn wir am Rande des Nervenzusammenbruchs stehen. Mir dünkt, dass da irgendwas schief […]
Hej, ich danke dir für die Erwähnung 🙂 Ja, da läuft was gehörig schief! Alles Liebe und ein schönes Wochenende, Katia
Ich glaube, dass es einen Unterschied zu früher gibt: die mental work load war kleiner und in Erziehungs- und sonstigen Lebensfragen herrschte viel mehr Konsens. Da steht man heute in vielen Dingen allein da und muss sich seine Meinung, seinen Standpunkt erarbeiten und vielleicht auch verteidigen. Damit will ich nicht sagen, dass es früher besser oder schlechter war – es war anders…
Auch gab es nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten – maximal mit der Nachbarschaft 😉 – kein Internet…
Und früher war es nicht so wichtig, sich selbst immer zu verwirklichen und das Beste aus sich und den Kindern zu machen. Das ist ebenfalls aus meiner Sicht eine Entwicklung, die subtil mehr Druck erzeugt als es früher der Fall war. (Auch da: das hatte auch seine Schattenseiten!)
Mir geht es selbst ähnlich… Oft frage ich mich, warum ich so viel Schlaf brauche… (8 Stunden müssen es eigentlich immer sein) – aber wenn ich dann schaue, was ich alles leiste, weiß ich warum. Oft frage ich mich, ob ich meinen Kindern genügend volle Aufmerksamkeit schenke (wenn man noch 10 andere Sachen im Kopf hat, ist das schwer).
Ich glaube, wir sitzen da alle im selben Boot und sollten uns viel öfter gegenseitig ermutigen und loben – das hilft nicht gegen Schlafmangel, aber verändert wenigstens ein bisschen die Stimmung 🙂
Liebe Andrea, das hast du sehr präzise formuliert – würde ich alles so unterschreiben! Unser Leben hat deutlich an Fahrt aufgenommen, was die Vereinbarkeit vieler Themen anbelangt. Ich glaube, wir sollten wieder lernen, uns besser abzugrenzen: von Erwartungen (den eigenen und den von außen), auch mal Nein zu sagen, zu delegieren, Dinge einfach sein zu lassen, die auf den zweiten Blick vielleicht so wichtig gar nicht sind. Aber uns gegenseitig zu ermutigen, zu loben, verständnisvoll zu sein, das ist auch so wichtig! Danke für deine Gedanken, alles Liebe, Katia
Liebe Katia,
Dein Text hat mich sehr berührt und ich finde du hat vollkommen recht….nur weil wir Mütter sind, wird automatisch immer erwartet dass wir in allem immer tapfer sind, als wären wir wie Roboter, die automatisch immer sofort auf gute Gefühle umschalten könnten. Einfach furchtbar finde ich das. Das ist wircklich das, dass mich am meisten nervt am Mutter sein. Sobald man nur einbisschen Aufmerksamkeit möchte oder jammert kommt schon der berühmte Satz; warum hast du denn Kinder? oder man ist schrecklich undankbar……so doof.
Und eigentlich ist ja soweit alles in Ordnung……kaum vorzustellen wie tapfer, dass man sein muss ,wenn etwas nicht so läuft , wie es sein sollte. Das habe ich leider die letzten Monate erlebt, bei meiner Schwester….eines ihrer Kinder ist leider sehr schwer erkrankt , es brauchte eine Blutstammzellspende. Sie haben es geschafft, sie waren beide, Mutter und Kind unglaublich stark und tapfer. Aber ich muss schon sagen, es war unmenschlich, wie viel Kraft und Tapferkeit von meiner Schwester erwartet wurde……
Ganz heftig. Und warum betrifft, das primär die Mütter ? Habe schon das Gefühl, dass das bei Vätern anders ist….warum ist das so fest in unserer Gesellschaft verankert ?
Ich glaube da sollte sich langsam etwas tun.
Alles Liebe aus der Schweiz
Christina
Hej liebe Christina, ja, die Erwartungshaltung – die eigene und die gesellschaftliche – ist immens hoch! Und wie du schreibst: Wenn on top auf den alltäglichen Wahnsinn aus Familie und Beruf, aus Verpflichtungen und 1000 To-dos noch etwas so Existentielles wie Krankheit kommt – dann kann man eigentlich nur noch kapitulieren. Was man natürlich nicht tun kann und will, sondern kämpfen, weil es um das einzig wirklich Wichtige geht: Unsere Gesundheit und die unserer Familie. Chapeau für die Kraft deiner Schwester, die stellvertretend für uns Mütter steht. Sage ihr einen Gruß von ganzem Herzen und dass sie sich davon erholen kann. Alles Liebe in die Schweiz, danke für deine Teilhabe hier! Katia
Liebe Katia, sehr treffend formuliert! Ich denke es geht den meisten Eltern so, aber darüber zu sprechen ist auch heute noch ein großes Tabu. Zumindest kommt es mir so vor. Redet man darüber, zeigt man Schwäche und wird noch kritisiert. Sagt man nichts, frisst es einen manchmal auf. Ich denke nicht, dass es die ältere Generation leichter, besser oder schwerer hatte. Es war anders. Es herrschte weniger Druck und ich glaube man war schneller zufrieden. Heute muss ALLES immer schneller, besser, größer usw sein. Uns geht es da nicht anders. Wir machen weiter, mit den 1000 to do’s, dem Versuch unseren Kindern die Aufmerksamkeit zu schenken die sie benötigen, denn ein Alltag mit Kindern, Job, Haushalt, Familie, Freunde usw erledigt sich leider nicht von alleine…
Vielen Dank für diesen herrlich ehrlichen Artikel! Liebe Grüße Katharina
Hej liebe Katharina, ich danke dir für dein liebes Feedback! Wir Eltern sind meines Erachtens kollektiv am Ende unserer Kräfte, weil uns immer mehr – und in den vergangenen zwei Jahren besonders – abverlangt wird. Vieles geschieht unmerklich, als schleichender Prozess: dass man mit kranken KIndern im HomeOffice eben doch irgendwie arbeitet, weil es alle anderen ja auch machen. Weitermachen ist Konsens, ausruhen verpönt. Das läuft gesellschaftlich in eine sehr ungesunde Richtung, wie ich finde. Leistung, ganz gleich wie, auf Kosten von uns allen. Wir müssen ganz dringend umdenken! Alles Liebe, danke für deine Gedanken, Katia
Liebe Katia, “ich fühle mich wie angeschossen” – das trifft es wirklich gut! Meine Mama hatte 4 Kinder und 2 helfende Omas, die hat alles total entspannt gerockt. Sie war eine junge Mutter und es gab weder Social Media noch WhatsApp Gruppen, und Trends wie Wichteltür und Halloween-Deko lagen in weiter Ferne. Wohnen war günstig und krank war krank, nicht Homeoffice.
Ich glaub, heute sind wir einfach überlastet durch die Vielfalt an Möglichkeiten, Input und Kommunikation, und den Anspruch der dadurch an uns (vermeintlich) entsteht. Ich bin zudem noch eine späte Mama und hab parallel zu kleinen Kindern schon die Eltern und Schwiegereltern gepflegt (und beerdigt). Dazu ein 30 Stunden-Job, weil die Miete zu teuer ist für ein Einkommen. Das kann ja nicht spurlos an einem vorbeigehen.. Danke für dein Appell zum Nein-Sagen und Pause machen, gerade jetzt im Advent.
Hej liebe Kathrin, auch wenn ich definitiv keine Verfechterin von “früher war alles besser” bin: Früher war es zumindest weniger komplex. Du hast es sehr gut zusammengefasst, all diese möglichen Facetten, die heute in unser Leben passen könnten oder sollten, all der durch Social Media entfachte und überbordend zur Schau gestellte Perfektionismus – allein das schlaucht. Plus Job, plus Kinder, plus Haushalt, Schule, Hobbys, Verpflichtungen anderen gegenüber – ein echtes Pfund. Eines, das an manchen Tagen so schwer wiegt, das man meint, es nicht mehr stemmen zu können. Von daher: Unbedingt mehr Neinsagen, mehr abgeben, aufgeben, bei sich bleiben. Gar nicht so einfach. Aber lohnt! Danke für deine spannenden Gedanken hier, alles Liebe, Katia
Ja, kenne ich.
Es gibt ja diesen Begriff der high functioning anxiety – nach außen sieht jemand aus wie bestens organisiert und das meiste wird geschafft, hinter den Kulissen sind Stress, Ängste und permanente Unruhe.
Irgendwo habe ich gelesen, dass sich nach den Covid-Jahren im Moment eigentlich eine ganze Elterngeneration im burn out befinde. Wer schickt uns alle denn jetzt endlich mal in Kur?!
Erschöpfte Grüße!
Hej liebe Sina, stimmt, der Begriff passt (leider!) auch ziemlich gut in diesen Kontext. Und es ist doch wirklich krass, dass solche Krisen immer diejenigen am härtesten treffen, die sowieso schon am meisten zu stemmen haben. Ich komm mit auf Kur! Ind diesem Sinne. Ein erholsames Wochenende – in er Advantszeit (harhar). Alles Liebe, auf bald, Katia
Dein Text trifft es so gut und auch die Kommentare…ich finde mich dort überall wieder. Auch ich bin pathologisch tapfer, mache einfach weiter. Es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Die Wäscheberge wachsen, die Küche sieht aus wie explodiert, die Kinder streiten rund um die Uhr, Weihnachtsplätzchen sollten gebacken werden und einen Job habe ich nebenbei auch noch…
Letzte Woche haben mir im Gespräch einfach Wörter “gefehlt”. Ich überlege gerade ernsthaft, mir “heimlich” Urlaub zu nehmen, ohne dass meine Familie davon weiß und mich zumindest am Vormittag zu erholen (oder endlich den Haushalt auf die Reihe zu bekommen). Liebe Grüße
Hej, ja, es scheint, als wären wir alle kollektiv “pathologisch tapfer” – was irgendwie kein Grund zur Freude ist…Die Wortfindungsschwierigkeiten kenne ich auch – und morgen nehme ich mir mit einer guten Freundin eine gemeinsame Auszeit ohne Familie: Ich brauch das gerade so sehr! Alles Liebe, nimm dir bloß auch deine Auszeit, Katia
Hey, ja, ein sehr passender Text!
Sich ich habe nach den letzten Jahren keine Kraft mehr – früher war ich mit drei Kindern plus deren Freunden im Schwimmbad, auf dem m Spielplatz, was weiß ich. Hab entspannt gearbeitet und kein Problem gehabt, wenn mal was liegen blieb… dann kam ein kranker Mann, eine Elternzeit nicht mit Baby nett zuhaus, sondern dazu plötzlich dreimal Homeschooling, Dann lieber wieder arbeiten, um Abwechslung zu bekommen, aber so toll Homeoffice sein kann, immer wieder nebenbei ist auf Dauer nicht stemmbar – wenn die Tage nie enden und das Gefühl bleibt, niemandem gerecht zu werden.
Dazu immer wieder etwas on top, chronische Krankheit beim Kind, ein wieder kranker Mann, ein Kollege, der geht, das Kind mit massiven Schulproblemen, …
Zuletzt habe ich mehrfach auf Kommentare, wie ich das alles so entspannt schaffe, beginnt, dass ich das nicht tue. Trotzdem fühlt sich das „Jammern“ auch wieder blöd an – ist doch echt vertrackt mit uns!
Hej liebe Annie, ja, wir Eltern sind kollektiv durch. Mir reicht derzeit schon tobiger Spielbesuch von einem weiteren Kind, um mir die Nerven zu zerfetzen…🙈 Energiereserven sind aufgebraucht. Das ist noch mehr spürbar, wenn auf den normalen Alltagswahnsinn noch zusätzliche Stressfaktoren wie Krankheit, Pflege, akute Krisen kommen. Eine Elterngeneration am Limit. Und darüber zu sprechen, sich auszutauschen, ist kein Jammern! Alles Liebe für dich, Katia