Ich stehe am Tresen, ein Baby auf der Hüfte, ein Kind an der Hand, eins im Auto. Der Apotheker schaut auf meine Hände, sie sind rau und an mehreren Stellen schon ganz wund. „Haben Sie viel Stress“? fragt er. Ich nicke. „Sie müssen auf sich achten“! Ich lächle. Kein Strahlelächeln, sondern eher eins mit Hohn. „Danke für den Rat, du Vogel.“ Könnte ich, würde ich…

Beim Verlassen der Apotheke, meldet sich eine Stimme, sie war schon ganz leise, nur noch ein Wispern im Hintergrund, nun sagt sie sanft aber bestimmend: „Katharina, mein Schatz, natürlich kannst du Dinge ändern. Fang mit deinen Gedanken an. Was empfindest du gerade als schlimm in deinem Leben? Was stresst dich am meisten? Du darfst Dinge lassen, um andere Dinge, die gemacht werden müssen, wieder mit einem weichen Herzen zu tun, ohne Groll!“
Ich schnalle die Kinder an, verteile Traubenzucker, schlichte Streit und ehe ich den Zündschlüssel umgedreht habe, verschwinden die ersten angeblich so wichtigen To-do‘s von meiner Liste.
Der Autor Joachim Meyerhoff, meinte letztens in der NDR Talkshow zu seinem erlittenen Schlaganfall: „Jeder der in seinem Leben mal einen Schicksalsschlag erlebt hat, kennt das Gefühl, dass der Schicksalsschlag sagt: „Bis jetzt hast du dein Leben gesteuert – aber jetzt übernehme ich.“

2017 ist unser ältester Sohn, damals 5 Jahre alt, an Leukämie erkrankt. Es folgten 2 Jahre Chemotherapie, die nicht nur ihn fast kaputtgemacht hätten, sondern auch uns Eltern. Sein eigenes Kind so leiden zu sehen, reißt einem das Herz heraus und es bedarf viel Arbeit, es beim Einsetzen weich zu halten, um nicht zu verbittern. Wir haben Kinder sterben sehen und die Flamme unseres eigenen Kindes ist fast erloschen. Bei all dem Leid haben wir angefangen, das Schöne im Hässlichen zu suchen. Haben lachend Pizza gegessen, mit dem Wissen, dass der Platz von unserem Sohn vielleicht bald nicht mehr besetzt sein wird.
Unser Sohn lebt und dennoch ist ein Stück von ihm gegangen.
Zwischenzeitlich hatten wir unser Leben nicht mehr in der Hand. Haben von Vormittag zu Nachmittag gelebt und nicht gewusst, was in der nächsten Woche auf uns niederschlagen wird.
Und doch gab es in dieser Zeit etwas Gutes. Die Menschlichkeit auf einer Kinderonkologie ist nahezu uneingeschränkt und obwohl es dort so viel Leid gibt, gibt es ebenso viel Klarheit. Wenn man dem Tod neben sich sitzen hat, dann wird einem bewusst, wie wertvoll dieses Leben ist. Plötzlich war es nicht mehr schwer, dass Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen.
So habe ich dem Schicksal ein Stück Leben abgeluchst, wieder ein Stück mehr Autonomie, selbst zu bestimmen, wo es hingeht. Nämlich nicht zu verbittern über unser Schicksal, sondern dankbar zu sein, für all die Menschen, die uns Essen vor die Tür gestellt haben und uns damit zeigten, dass wir nicht allein sind. Für die gute medizinische Versorgung in unserem Land, für das eigene Bett, für Netflix.
Die Fähigkeit, Freude zu empfinden im tiefsten Leid und das Leben zu feiern wie es kommt, birgt eine unbändige Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit spendet Kraft für das was noch kommt, sie ist geduldig an den Tagen, an denen die Tränen nicht aufhören wollen zu fließen und die Angst den Körper mit Tauen so fest umwickelt hat, dass man sich laut schreien winden muss, um sich zu befreien. Zufriedenheit besänftigt den Zorn, lässt die Ohnmacht und Verbitterung über die eigene Handlungsunfähigkeit versinken und füllt das verkrampfte Herz mit Glück, sodass es warm wird und sich lösen kann.

Samuel Koch sagt: „Der Punkt ist eher, die Realität des Todes als ultimative Grenze anzuerkennen, die vieles im Leben relativiert. Und priorisiert. Wenn unser Leben unendlich wäre, hätte ja nichts wirkliche Dringlichkeit. Die Tatsache aber, dass wir irgendwann sterben werden, verleiht unserem Leben einen viel größeren Wert, weil es nur einmal stattfindet und zeitlich begrenzt ist. Es gibt ein ‚zu spät‘, es gibt einen Schlusspunkt.“
Ich entschied mich, in Augenblicken der völligen Finsternis etwas zu finden, das schön ist und es zu genießen.
“Weil mir klar wurde, dass die Zeit mit den Menschen, die man liebt, mit den eigenen Kindern, endlich ist. Ich fing an, mich dankbar durch die Berge dreckiger Wäsche zu wühlen, denn Wäsche waschen zu müssen bedeutet, dass lebendige Kinderkörper sie zuvor verschmutzt haben.
Ebenso erschien es mir auf einmal sinnlos, jetzt Angst vor etwas zu haben, von dem ich gar nicht weiß, ob es eintritt und damit die Zeit in der Gegenwart zu zerstören. Jetzt findet das Leben mit meiner Familie statt, schöne anstrengende Stunden, voller Sinn und Fülle.“ (Auszug aus meinem Buch „Der Chemoritter am Küchentisch – Das Jahr, in dem unsere Familie Krebs bekam“)
Die Erinnerung ist wieder da: Wir müssen so wenig.
Ich bin nicht der Typ, der alles verkauft, aus der Gesellschaft aussteigt, um mit einem Merinopulli um die Hüften, mit Rucksack auf dem Rücken und den Kindern an der Hand, um die Welt zu reisen. Das muss ich auch nicht. Um auszusteigen, muss ich nicht gehen.
Ich mag unser Haus in Brandenburg, dass es so alt, so muckelig und gemütlich ist. Ich will hier sein. Meinetwegen auch mit dieser Gesellschaft aber ich will nicht überall „hier“ rufen müssen, damit mich meine Umgebung gern hat und ich mich damit auch. Ich will ebenso die nächsten Jahre, wenn für alle anderen Gras über den Krebs unseres Sohnes gewachsen ist, noch den Mut haben, nicht überall mitzumachen. Elternabend? Nö, mir reicht das Protokoll! Meine Kinder ständig hier da und dorthin fahren, nur weil man das so macht? Nö, lieber Geduld üben und Strecken der Langeweile aushalten! Mich aufregen, weil die Mutter von Paul sich aufregt? Nö!
Aber atmen, das fände ich toll. Ja, atmen möchte ich weiter. Und da sein für die Menschen die ich liebe. Platz für die Probleme von den Personen schaffen, die ich in mein Herz gelassen habe.
Ich möchte Liebe für andere speichern und dafür brauche ich Kapazität für Herzenswärme und muss mich dafür zunächst einmal selbst mögen.
Selbstliebe hat immer etwas mit Selbstlosigkeit zu tun. Unser Handeln bestimmt uns, nicht unser theoretisches Vorhaben, die Gedankengebäude in der Nacht. Wenn ich gebe, dann empfange ich. Am besten ist geben, ohne große Planung: “Du brauchst einen Kindersitz? Wir wollten unseren bei EBay verkaufen, ja klar, könnt ihr ihn uns abkaufen aber weißt du was? Wir schenken ihn euch.”
Solche spontanen Entscheidungen fühlen sich gut an, für beide Seiten.
Und genau diese Strategie der Selbst- und Nächstenliebe hilft, das Schöne im Hässlichen zu sehen und auch ohne alles verkaufen zu müssen, auszusteigen.

Der Autor und Pastor Tomas Sjödin schreibt in seinem Buch „Es gibt so viel, was man nicht muss“: „Das Leben, das man führen möchte, ertrinkt in dem Leben, zu dem man sich gezwungen sieht, und meines Erachtens gibt es nur einen Weg zurück: regelmäßige Momente der Stille und des Nachdenkens“.
Dann lerne ich folglich nicht noch besser und schneller schwimmen, sondern plansche erst einmal einfach nur mit den Füßen uns es fühlt sich gut an.
PS. Mehr kluge Sätze und Gedankenanstöße gibt’ s in meinem Buch: “Der Chemoritter am Küchentisch”.
Alles Liebe,








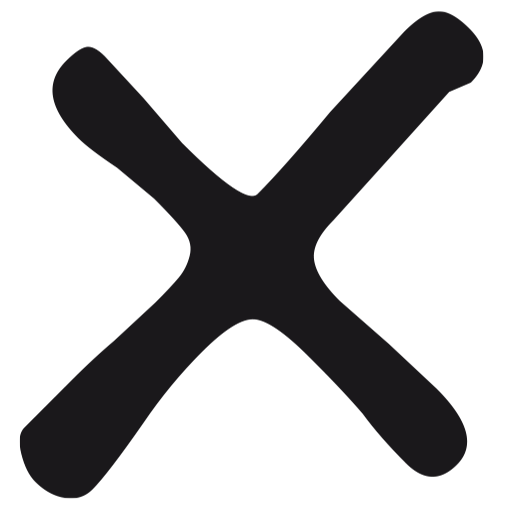
Hallo!
Das Geräusch das ich machen musste nach diesem Text, kann ich nicht aufschreiben. Es war ein langes Ausatmen gefüllt mit Respekt und guten Wünschen.
Danke für diesen gefühlvollen und ehrlichen Text!
Lasst es euch ganz gut gehen…
Heidi
Ich kämpfe selber gerade gegen Krebs und kann diese Gedanken so gut nachvollziehen. Ich hatte in den letzten Tagen zwar ein kleines Tief, kämpfe mich aber in diese Sichtweisen nun zurück. Ich bin so gelassen, demütig und dankbar für so viel Gutes, das da gerade passiert! Tatsächlich träume ich von dem Rucksack, mit dem meine Männer und ich gemeinsam losziehen können. Das war allerdings schon vor der Diagnose so – wir sparen seit ein paar Jahren auf ein Sabbatical. Und wenn Corona und der Krebs uns lassen, dann geht es nächstes Jahr im August los. Ein Ziel wofür es sich lohnt zu kämpfen.
Und bis dahin – ATMEN!! Tief ein und aus!
Alles Liebe
Annika
@annikaoninsta
Vielen Dank für diese warmen wahren Worte, die mich direkt ins Herz getroffen haben! ❤️
So ein schöner Text. Bei uns in der Familie ist gerade viel im Umbruch-ich selbst mache gerade auch eine Chemotherapie- und ich übe mich in Demut!Nach einer langen Strecke von Angst,Wut und Trauer kehrt nun auch die Freude zurück!
Danke Katharina für den warmherzigen,ehrlichen Text und Danke Claudia für das Thema!
Wärme Grüße zu euch!
Judith
Liebe Claudi, liebe Katharina,
schon wieder ein Text, bei dem ich schniefen musste … sehr wichtig und so gut geschrieben.
Danke dafür!
Liebe Grüße
Dorthe
Liebe Katharina, liebe Claudia,
puh, vielen lieben Dank für diese berührenden, ehrlichen und herzerwärmenden Worte!
Herzensgrüße, Madlen
Hallo Katharina, ich möchte Danke sagen für diesen Text. Unser Sohn Paul ist 2018 mit 19 Monaten an einem Retinoblastom erkrankt. Augenkrebs. Nach acht Tagen Bestrahlung brauchte er noch 3 Blöcke Chemotherapie. Der Tumor ist noch da aber verkapselt. Es geht unseren Sohn gut im Moment. Die Zeit nach der Diagnose war hart und ich war so voller Wut. Auf jeden und auf alles. Ich hätte den ganzen Tag nur schreien können vor Zorn. Ich konnte auch nicht einfach mehr an irgendwelchen normalen Gesprächen teilnehmen denn ich dachte immer nur:; Was habt ihr eigentlich für Sorgen ? Aber auch wir haben irgendwann das positive aus der Situation gezogen und sehen alles ganz anders. Wir genießen jeden einzelnen Augenblick mit unseren drei Kindern und fokussieren uns nur noch auf wichtige Dinge im Leben! Auf uns selbst und unsere Familie,. Ich wünsche dir alles liebe und gute. Du hast mich mit deinen Worten so persönlich getroffen, dass ich das Gefühl hatte das du zu mir sprichst. Liebe Grüße Franziska
So ein toller Text. Vielen Dank dafür- vielen vielen Dank.
Das ist ein ganz wunderbarer Text, der für mich gerade sehr zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ich danke Dir bzw. Euch.
Oh mein Gott❤. Was für ein wundervoller Text, jede Zeile zeigt mir, das Demut, Dankbarkeit und Zufriedenheit nach ganz hinten gerückt sind und wir derzeit nur im “muss” leben. Ich danke dir von Herzen für deine tollen Worte und wünsche dir und deiner Familie aus tiefstem Herzen nur das beste für eure Zukunft.
Danke!!
[…] dann, tja, wie so oft: wasfürmich. Diese Geschichte von Katharina Weck hat mir für einen kurzen Moment die Luft zum Atmen genommen: Dankbarkeit hat für mich in den […]
Liebe Katharina,
danke! Das Leben, so unvorhersehbar, unplanbar und heraufordernd lässt einen oft nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Danke für deinen Text! Er erdet. Gut, dass wir einander haben und gut, dass wir nicht uns nur haben… Seid reich gesegnet!
Liebe Grüße, Mirjana