Übers Kinder haben sagt man, es kehre das Beste und das Schlechteste aus einem heraus. Auf das Leben in einer Pandemie trifft oft vor allem zweiteres zu. Da tun sich plötzlich Charakterzüge auf, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Zum Beispiel dieser: Seitdem sich das Leben räumlich minimiert hat, scheint auch das Denken enger. Man sieht nur nur die Dinge in unmittelbarer Reichweite. Und die dafür um so ausgeleuchteter. Der Blick über den Tellerrand scheint plötzlich ein Ding der Unmöglichkeit, der Horizont dahinter unerreichbar. Ich fürchte, Corona macht spießig.
Ich benehme mich plötzlich wie die chronisch schlecht gelaunten Nachbarn bei “Die Kinder aus dem Möwenweg”. Dauernd ertappe ich mich bei Sätzen, die ich niemals sagen wollte – zumindest nicht in der Frequenz: “Nicht durchs Beet trampeln!” “Räum dein Zimmer auf!” “Mit DEN dreckigen Füßen kommst du mir aber nicht ins Haus!” Alles ist mit mindestens einem Ausrufezeichen versehen, die auch lange Zeit danach noch im Raum hängen. Und an denen ich mir gehörig den Kopf stoße. Denn ehrlich gesagt: Ich mag mich so kleinkariert-kläffig am wenigsten leiden.
Jede Saftpfütze, jeder schmierige Händeabdruck auf der Wand scheint für mich gerade wie mit neonfarbenem Marker umrandet.
Weswegen es mir auch kaum möglich ist, über diese alltäglichen Mini-Katatrophen einfach hinwegzusehen. Klar, das Zerstörungspotenzial meiner drei Kinder hat mich auch vor Corona nicht unbedingt zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Aber ich habe es irgendwie mehr hingenommen. Leben mit kleinen Kindern ist halt so. Punkt. Aufwischen, kein Gewese drum, sondern weitermachen.
Aber seitdem unser Familienleben auf die Qudratmeter unseres Hauses zusammengeschnurrt ist und ich nirgendwohin ausweichen kann, springt mich all das überdeutlich an. Und nervt mich kolossal – obwohl ich mich mit solchen Banalitäten eigentlich nicht abgeben wollte.
Vielleicht ist es der Wunsch nach ein wenig Autonomie in diesem nach wie vor beschränkten Leben.
Und sei es, dass wenigstens meine eigene kleine Welt heil bleibt. Oder zumindest das Mobiliar, Geschirr, die Bücher darin. Aber gerade kämpfe ich jeden Tag den Kampf zwischen Soll- und Ist-Zustand. Und obwohl ich weiß, wie unnötig, wie vergeblich es ist, kann ich nicht dazu auf Distanz gehen. Dabei ist das doch die größte Errungenschaft der Pandemie: Die Fähigkeit, Abstand zu wahren.
Vielleicht kann ich es aber so schlecht ignorieren, weil ich es ununterbrochen vor der Nase habe. Denn: Die Kids haben eigene Zimmer, klar. Aber spielen tun sie drinnen fast ausschließlich im Radius von fünf Metern um mich herum. Türmen Haufen auf. Verwandeln das Zimmer sekundenschnell in einen Vorhof zur Wohn-Hölle. Eine Wohlfühl-Ordnung gibt es gerade weder im Außen noch im Innen. Überall ist Chaos, überall Enge. Vielleicht auch eine Art psychische Long Covid-Folge: Das Talent, mit diesem Umstand gelassen umzugehen, habe ich zumindest temporär verloren.
Beschränkungen machen beschränkt.
Denn: Natürlich könnte ich meinen Blick auf andere Dinge richten. Aber das große Ganze ist im Laufe der letzten Monate außer Sicht geraten. Was – die Welt ist größer als meine Familie, unsere Provinz?! Ach ja, stimmt. Es ist wie etwas, das ich vor Urzeiten mal in der Schule gelernt habe – wirklich nachvollziehen, wirklich fühlen, kann ich es gerade oft nicht mehr.
Wenn ich den Blick über den Tellerand meiner Familie hebe, endet er derzeit manchmal direkt am Gartenzaun. Und wundert sich mit hochgezogenen Augenbrauen darüber, dass IMMER DANN Rasen gemäht, gehämmert, emsig Lärm gemacht wird, wenn ich mal zwei Minuten auf der Liege die Augen schließen will. Oder in Ruhe Kaffee trinken, während die Kinder ENDLICH MAL FRIEDLICH UND STILL SPIELEN.
Und dann möchte ich vor Selbstscham direkt im Boden versinken.
Habe ich das wirklich gerade gedacht? Aus welchen spießigen Untiefen kommen solche Dinge ans Tageslicht? Ich kann es nur mit meiner Corona-Dünnhäutigkeit entschuldigen. Meine Zündschnur ist mittlerweile extrem kurz. Die kleine Welt, in der man sich seit über einem Jahr bewegt, ist immer präsent, immer ein wenig zu nah. Und der Rest der Welt, in der all das keine Rolle spielt, nach wie vor viel zu weit weg.
Immerhin tröstlich: Scheinbar bin ich nicht allein mit dieser peinlichen Erkenntnis. In der Rubrik “Gefühlte Wahrheit” der SZ war kürzlich ein sehr passendes Tortendiagramm mit der Fragestellung “Wie Deutschland sich fit hält in diesem Frühjahr” abgebildet: Ein Bruchteil mit “Yoga allein”, ein ebenso geringer beim “Joggen mit Lebenspartner”. Und der entlarvende Großteil mit “Kopfschütteln über die Nachbarn”. So sehr hat uns diese Pandemie alle inzwischen mürbe gemacht.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass der Zustand nicht von Dauer sein wird.
Fallen die Beschränkungen im Außen, dann auch im Inneren. Gerade wird es am Horizont ja bereits heller. Gerade wird die Sicht wieder freier auf das Leben dahinter. Eines, in dem wir uns nicht mehr alle unfreiwillig geballt an einem Ort sammeln. Sondern uns endlich wieder in die Welt versprengen – auf den Fußballplatz, in Restaurants, in ein Ferienhäuschen – halleluja! Dann werden alltägliche Banalitäten hoffentlich wieder das, was sie sein sollen: Nebensächlichkeiten, an die man keinen zweiten Gedanken verschwenden soll.
Bis es soweit ist, greife ich auf eine ebenso simple wie bewährte Taktik zurück: Ein Ortswechsel, und sei er noch so klein, hilft mir und uns immer. Mit Sofortwirkung: Ein Gang an die Elbe, eine kurze Fahrradrunde ums Dorf – Hauptsache, der Kopf lüftet alle seltsamen Gedanken aus. Hauptsache, unsere Augen kriegen etwas anderes vor die Linse als das ewig gleiche Bild von Küche, Chaos, Couch. Dann seh ich den Kindern dabei zu, wie sie mit Anlauf in die Matschpfütze springen, einen Haufen aus Steinen errichten, den Strand in Besitz nehmen. Lasse meinen Blick elbabwärts bis zum fernen Horizont schweifen. Und sehe: Dahinter geht’s noch viel, viel weiter.
Findet ihr euch auch manchmal kleinkarierter als ihr jemals sein wolltet…?
PS: Sollten euch “Die Kinder aus dem Möwenweg” bislang noch kein Begriff sein: Lest unbedingt die großartige Buchreihe von Kirsten Boie vor. Die lieben hier alle drei Kinder – der Jüngste eher die ebenfalls superschöne Serie dazu.
Alles Liebe,









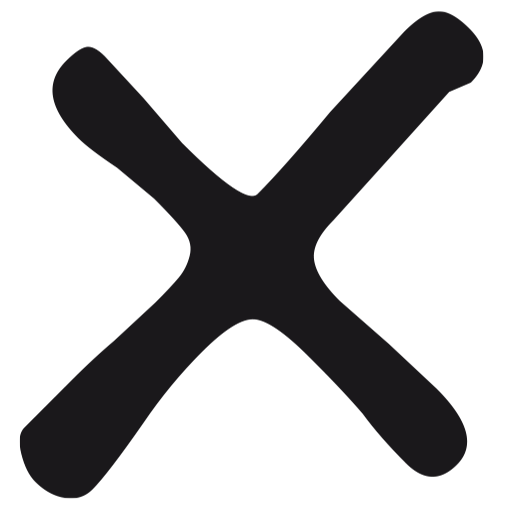
Hilfe mir geht es genauso. Sonst war ich zB beim Thema Ordnung zuhause recht locker, habe immer gesagt die Kinder leben schließlich auch hier und sollen sich wohl fühlen und das darf man auch sehen… Momentan ist das Spielen im Wohnzimmer Streitthema Nummer 1, ich kann die Unordnung momentan leider nur sehr schwer ertragen und das nehme ich mir selbst oft sehr übel. Hoffentlich ändert sich das bald wieder.
Viele liebe Grüße
Nina
Hej liebe Nina, ich mag mir manchmal selbst nicht mehr zuhören 🙈 Weil ich mich selbst so daneben finde! Wahrscheinlich muss man sich gerade mehr nachsehen als sonst – das rüttelt sich bestimmt wieder zurecht! Alles Liebe!
Huhu, mir geht es genauso! Ich finde mich selbst ganz furchtbar, ständig unzufrieden- wünsche mir für mich und die Kinder meine „normale“ Tiefenentspannung zurück.
Und endlich mal wieder in Ruhe zuhause sein – in dann sicher nicht aufzuräumen, sondern den Platz genießen. Es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass es sich anderen so geht.
Hej liebe Annie, Tiefenentspannung in Bezug auf alles wäre DER eine Wunsch an die Fee…;-) KOmmt bestimmt wieder – hoffe, dass wir es dann gebührend genießen. Alles Liebe