Ab dem Moment, in dem ich mein erstes Kind herauspresste, war ich Mutter – und das für immer. Ansonsten blieb und bleibt nichts gleich. Wenn ich zurückschaue auf meine zwölf Jahre als Mama, dann kommen sie mir in seltsamer Gleichzeitigkeit irre lang und verdammt kurz vor. Hier ein Rückblick auf all die Mütter, die ich war. In gespannter Neugier auf die, die da noch kommen…
Die “Bitte lass es klappen-Mutter”
Ab dem Moment in dem wir beschlossen, ein Baby zu bekommen, konnte ich an kaum etwas anderes denken als daran, ein Baby zu bekommen. Heute ärgere ich mich manchmal, dass ich an die Kinderkriegkiste so ängstlich drangegangen bin. Statt es locker anzugehen und den verrückten Plan zu genießen, vielleicht demnächst ein Baby zu machen, habe ich mir von Anfang an ziemlich viel Druck gemacht. Statt es einfach laufenzulassen, pinkelte ich auf Fruchtbarkeitsstäbchen.
Ich glaube, ich wollte so unbedingt gern mehrere Kinder bekommen, dass ich von Anfang an Sorge hatte, dass es nicht klappen könnte. Mit 32 hatte ich nicht so furchtbar viel Zeit. Das hat mir viel Leichtigkeit genommen. Mein Mann rollt immer noch mit den Augen, weil ich ihn nach zwei Monaten vergeblichem Probierens sofort zum Spermagramm schicken wollte. Ich googelte hunderte Male am Tag Begriffe wie “Schnell schwanger werden.” Später auch: “Wie bekomme ich ein Mädchen?”, worüber ich mich heute ärgere. Aber zu der Zeit war es eben so.
Die “Glück-im-Bauch-Mama”
Mit Baby im Bauch war ich immer noch ab und zu ängstlich, aber die meiste Zeit über dauergrinsend glücklich. Ich war jedes Mal super gern schwanger. Ich hatte bei allen vier Schwangerschaften nach drei müden Monaten Energie ohne Ende und hätte liebend gern noch zwanzig weitere Babybäuche herumgetragen. Ich klebte reihenweise Ultraschallbilder mit gummibärähnlichen Kreaturen in Erinnerungsbücher.
Ich war verrückt nach meiner Kugel. Ich machte dutzende Fotos und filmte Babybauchtrittvideos. Ich bestellte gleich mehrere große Leinwände mit Big-Bauch, weil ich die Zeit so magisch fand und mir sicher war, sie für immer auf diese intensive Weise magisch zu finden. Heute hängen die Bilder schon lange nicht mehr. Ich schaue mir auch super selten Videos davon an. Viel lieber gucke ich meinen Kindern zu, wie sie aktuell durch den Garten flitzen. Manchmal aber, vor allem abends, schließe ich die Augen, lege eine Hand zurück auf meinen Bauch und gedankenschwänger mich zurück. Ich kann mich gut erinnern, wie hart der Bauch war und wie groß. Nur das Gefühl des ersten Kribbelns und der Tritte ist weg. Die hat mein Körper leider gelöscht – genau wie den Schmerz der Geburt (den allerdings zum Glück!).
Die “Hormon-Heul-Mama”
Mitten im wilden Alltag heute, vergesse ich manchmal, dass da zum Beginn meiner Babyromanze oft auch eher Tränen als Glückseligkeit waren. Wenn ich genauer nachdenke, sehe ich mich sogar dauerschluchzend mit meinem ersten Sohn da sitzen. Er war drei Wochen zu früh geboren und unglaublich zart, ich hatte Stillprobleme und Angst, das er verhungern würde. André warnte meine stolzen Eltern vor der Krankenhaustür, dass sie nicht wie geplant eine glücklich Mutter, sondern ein weinendes Wrack besuchen würden.
Was die Hormone noch gemacht haben: Mir das Gefühl gegeben, mein Leben sei zu Ende und für immer versaut, weil ich anfangs nicht stillen konnte. Später dann Milcheinschuss, wenn ich bloß ans Baby dachte. Dazu: Losheulen beim Tatort – und bei der Merci-Werbung. Überhaupt heule ich ständig, seit ich Kinder habe. So als wäre bei der Geburt nicht bloß die Frucht-, sondern auch die Tränenblase geplatzt. Außerdem war ich damals absolut überzeugt davon, dass die Wahl der richtigen Kuscheldecke lebensentscheidend ist.
Die “Mit-Haut-und-Haaren-Mama”
Für kinderlose Freundinnen muss ich in den ersten Kinderjahren wirklich anstrengend gewesen sein. Von null auf hundert wandelte ich mich von der Partymaus zur Stillen-ist-Liebe-Verfechterin. Von der ehrgeizigen Journalistin zur lieb lächelnden “Kann-meine-Elternzeit-bitte-für-immer-gehen”-Wünscherin. Feminismus hin oder her – ich hätte nicht einen Monat meiner Elternzeit hergeben wollen. Statt Artikeln schrieb ich begeistert Begriffe wie “Babub” und “Daaaa” in unser Sprüchebuch. Ich war mit verschwitzter Haut und ausgerissenen Haaren Kleinkindmama und irgendwie überzeugt, genau so würde es für immer sein.
Im ersten Jahr mit meinem ersten Sohn dachte ich, ich hätte überhaupt keine Zeit. Im Nachhinein hatte ich unendlich viel Zeit, mit anderen Mamas im Café zu sitzen oder auf Krabbeldecken in Gärten zu liegen. Mein Horizont war damals nah und sonnenaufgangsrosa. Am besten verstand ich mich mit den Freundinnen, die vom Babyrhythmus her am meisten auf auf meiner Welle waren. Ich trieb wahnsinnig gern in der Babybubble.
Die müde “Wut-Mutter”
Die Kinder wurden mehr und größer und mich traf die Erkenntnis wie ein Faustschlag, dass ich mein Kind nicht dauerhaft glücklich machen konnte. Kind fing an wütend zu werden – und ich wurde es auch. Da war keine schmatzende Symbiose mehr, da wurde sich auf den Boden schmissen, da wurde mein Essen verweigert. Ich fühlte mich unfähig und fett und hatte permanent das Gefühl, niemanden gerecht zu werden. Manchmal schrie ich so laut, dass ich mich danach weinend im begehbaren Kleiderschrank versteckte. Ich schämte mich so. Ich war eine ganz andere Mutter, als die, die ich sein wollte.
In dieser Zeit landete ich ziemlich unsanft auf dem Mamarealtitätsboden. Kam nicht damit klar, dass mein Baby auf Entdeckungsreise gehen wollte und für mich bloß Breiflecken und Dreckwäsche blieben. Ab und zu fühlte ich einen Hauch von Lust, in mir drin nach mir, statt nach Milch zu suchen. Aber immer wenn ich gerade ein Stück Claudi wiedergefunden hatte, kam das nächste Kind.
Die “Coole Mum”
Irgendwann fing ich an, das Chaos nach und nach zu akzeptieren. Ich ließ die Krümel unterm Tisch liegen, statt sie sofort wegzufegen. Ich begann immer mehr an meinem Jobtraum zu arbeiten. Ich merkte, dass ich eine bessere Mama war, wenn ich morgens „was für mich“ machte. Ich verzieh mir, dass nicht alles ging. Ich traute mich, meinen Kindern Dinge zuzutrauen. So liefen sie mal mit Fleck auf dem Pulli in die Schule – und mit nicht zueinander passenden Socken sowieso. Wenn ich keine Zeit hatte, gab es abends Tiefkühlpizza. Ich stellte den größer werdenden Kindern ihre Wäsche vor die Zimmertür, ich hörte auf, still und heimlich ihre Zimmer für sie aufzuräumen. Es tat gut zu spüren, dass sie mich liebten, obwohl ich nicht zu allem Ja sagte.
Die Einsicht, dass meine Kinder später wohl kaum rückblickend denken werden: “Es war bei uns zuhause immer so schön geputzt”, entspannte mich, machte mich zu einer ziemlich lässigen Mutter. Nicht immer, aber öfter. Langsam traute ich mir alles zu: Ich packte auf dem Weg zur Kürbisscheune noch vier Nachbarskinder ein, denn mal ehrlich, was sollte ihnen dort schon Lebenbedrohliches passieren? Ich fing an, Glaubenssätze zu hinterfragen. Ich machte keine Sachen mehr, nur “weil man sie eben so machte.” Es war wie ein Befreiungsschlag.
Die “Vertrauende Mami”
Heute lasse ich immer weiter los. Ich akzeptiere täglich mehr, dass sie eigenständige Wesen mit eigenen Ideen und ihrem eigenen Geschmack sind. Ich vertraue ihnen. Und ich habe einige Dinge endgültig aufgegeben. Ich versuche zum Beispiel erst gar nicht mehr, zu arbeiten und nebenbei ein Kind zu bespaßen. Vielmehr nehme ich an solchen Tagen selbstbewusst hin, dass mein Kind eben mal einen Vormittag vor der Glotze hängt. Deswegen wird es kaum gleich zum Schulversager werden. Überhaupt habe ich mir als Graffiti in meine Gedanken gesprayt: Es ist bloß Fernsehen, kein Heroin! Entspann dich.
Wenn ich darüber nachdenke, bin ich all diese Mütter auf einmal. Und sicher längst auf dem Weg, noch eine andere mehr zu werden. Was mich sehr beruhigt: Zeiten kommen und gehen, gute wie schlechte. Mir das bewusst zu machen und alle Gefühle anzuerkennen, hilft mir total beim Mamasein. Und bei allem anderen auch.
PS. Dieser Text ist inspiriert von dieser Geschichte.
Foto: Ilona Habben
Alles Liebe,









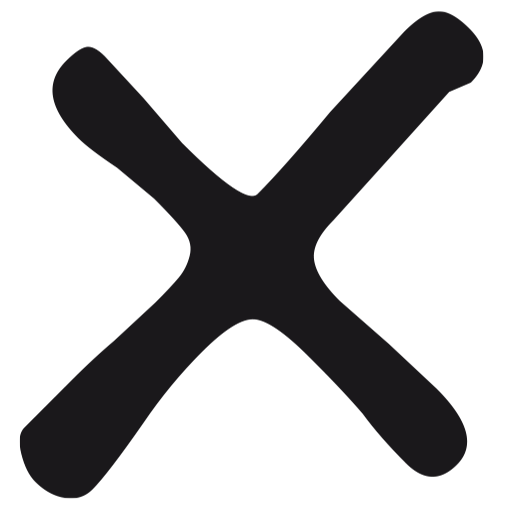
Was für ein toller Text! Ich finde mich sehr wieder, danke dafür!
Herrlich! Mein 4. Kind ist Anfang August geboren und ich musste so oft schmunzeln, weil ich mich oft wiedererkannt habe. Allein schon, wenn ich daran denke, wieviele Gedanken ich mir bei Nummer 1 um die Auswahl der Wundschutzcreme gemacht habe… und was man im Alltag mit Nummer 1 alles als Herausforderung gesehen hat und was jetzt bei Nummer 4 nebenbei laufen muss…
Ich hoffe sehr, dass ich mich in deinen zukünftigen Mamas dann auch wiederfinde!
Danke für den schönen Text!
So schön!
So ein schöner Text! 🙂
Vielen Dank für deine tollen Worte!
Hey Claudi,
Das tut so gut zu lesen. Ich frage mich selbst derzeit ganz oft, wer ich bin und wer ich noch werden möchte. Ich glaube, ich bin gerade dabei mich selbst ein wenig wieder zu finden. Und einerseits froh darüber, andererseits auch ein bisschen wehmütig, dass um Moment oder vielleichtbsuch überhaupt kein weiteres Baby kommt.
Oh ja, das ist so ein „Beides auf einmal“-Gefühl. Aber ich finde, es lohnt sich, sich um sich zu kümmern. Ich finde, damit gibt man auch den Kindern ein gutes Gefühl!
Alles Liebe,
Claudi
❤️
Danke dir für dein ❤️.
Ich freue mich immer so hier Lebens- und Lesezeichen von euch zu bekommen.
Alles Liebe,
Claudi
Soo schöner Text, sehr inspirierend
Das freut mich total!
Alles Liebe,
Claudi
Toller Text! Er regt mich an, zu überlegen, welche Mütter ich schon war und bin.
Wie schön, das hatte ich gehofft. Danke für dein schönes Feedback!
Herzlichst, Claudi
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Danke für das ❤️-liche Feedback! 😉
Alles Liebe,
Claudi
Liebe Claudi, danke für diesen Einblick und den Impuls über meine eigene Rolle und ihrer Veränderung nachzudenken. Ich war im letzten Jahr sehr damit beschäftigt mein Wunsch nach einem weiteren Menschlein ziehen zu lassen und merke wie ich mich darauf freue, auf das was da kommt mit einem Schulkind und einem 3jährigen und mehr Zeit für mich!
Das klingt wirklich gut. Verrückt wie sich immerzu alles wieder ändert.
Aber im Nachhinein fühlt es sich dann oft richtig an.
Liebe Grüße,
Claudi
Ein wunderbarer Text!!! Tröstend, Mut machend, inspirierend und sich auf die Zukunft freuen lassend 💜
Danke, danke, danke! Genau so war es gedacht.
Alles Liebe,
Claudi
Deine Worte treffen so oft mitten in mein Herz. Danke!
Danke dir für das liebe Feedback!
Beste Grüße,
Claudi
Halleluja, Dankeschön🥰 Samstagmorgen und endlich mal Zeit, hier nachzulesen…alles schläft noch, eine wundervolle Zeit!
Ich musste schmunzeln, denn als wir vor drei Wochen gerechtigkeitshalber die mit Namen bestickte Kuscheldecke für Nummer 3 bestellt haben, von der ich bei Nummer 1 und 2 voll überzeugt war, fragte ich meinen Mann:“ Warum machen wir das eigentlich? Glauben wir ernsthaft, dass sie sie die später als Erinnerung mitnehmen? Die ist ja viel zu klein und ihre eigenen Kinder heißen hoffentlich nicht so wie sie😂😂😂!“ Tja… die Kuscheldecke und dann lachten wir!
Danke für deinen inspirierenden Text. Ich bin auch einige von all diesen Müttern und liebe es, die Veränderung zu sehen.
Hab ein schönes Wochenende!
Haha, danke für diesen herzlichen Lacher. Das kenne ich so gut! Vielleicht ein Tipp an alle Neu-Mamis hier: Krabbeldecke gleich größer bestellen, dann taugt sie eventuell noch fürs Teeniezimmer.
Ich freu mich auch riesig, dass du es dir mit uns am Samstag morgen gemütlich machst.
Ganz liebe Grüße,
Claudi
Was für ein wundervoll wundervoller Text! Genau das habe ich gerade gebraucht, mit kind zwei lande ich gerade in der Realität und vermisse mich und die kuschelmama, aber du machst mir Mut.
Toll… Ich hab Tränen in den Augen. Schön, dass es auch anderen so geht. Danke für diesen tollen Text.
Danke für dein liebes Feedback!
Claudi
Hallo Claudi, der Text, Deine Wort sind mal wieder ganz wunderbar. Er trifft mich genau in mein Mamaherz und zum richtigen Zeitpunkt. Es sich zu erlauben mehrere Mamas zu sein, macht das Leben doch gleich etwas leichter. Sich selber bewusst weiterzuentwickeln und dann auch noch zu wissen, dass andere ähnlich fühlen und sich darüber austauschen, ist ein schönes Gefühl.
Vielen Dank für diese ehrlichen Wort und den Blick in Deine Gefühle.
Viele Grüße Katrin